
Im neuen Jahr hat sich der Bundesverband der Selbsthilfe (SH) Österreich BVSHÖ wieder viel vorgenommen. Die Wege und Visionen für ein noch besseres Auftreten im Gesundheitswesen können jedoch nur in Zusammenarbeit mit allen Vertreter*innen der nationalen SH-Organisationen sowie der SH-Landesdachverbände und –Kontaktstellen erreicht werden. Dazu müssen wir noch besser mit den gesundheitlichen sowie sozialen Entscheidungsträger*innen zusammen-arbeiten. Am 12. April gab es dafür die erste Fachtagung im neuen Gebäude des Dachverbands der Sozialversicherungsträger. Es war erfreulich, dass dabei auch der ORF-Nachrichtensprecher Mag. Tarek Leitner als Moderator gewonnen werden konnte.

Präs. Angelika Widhalm, Moderator Tarek Leitner, Vize-Präs. Waltraud Duven
Zum Beginn begrüßten Präsidentin Angelika Widhalm und ihre Stellvertreterin Waltraud Duven die zahlreichen Teilnehmer. Nach den ersten Vorträgen war klar, dass eine Basisfinanzierung leider immer noch fehlt. Dafür forderte Andreas Huss von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eine noch genauere Auflistung des Angebots aller Selbsthilfegruppen und –verbände.
Nach der Mittagspause berichteten Vertreter*innen von deren Tätigkeiten ihrer unterschiedlichen Dachverbände aus fünf Bundesländern. So will die Selbsthilfe Kärnten deren Auftreten im ländlichen Bereich verstärken. Auch in Niederösterreich ist in jedem Bezirk eine eigene Zentrale geplant. In Oberösterreich will man SH-freundliche Firmen hervorheben, die dadurch das Angebot für SH finanziell erleichtern sollen. Die Tiroler suchen nach einem Mitspracherecht bei deren politischer Regierung und in Wien will man die Werbefilme in den Arztpraxen erweitern.
Die abschließenden Workshops waren in drei Gruppen geteilt. Dabei ging es bei einem um die geplanten Wege zur Verbesserung. Hilfreich wäre eine Info über passende SHG im Entlassungsschreiben von Krankenhäusern. Der Zugang und auch das Stimmrecht in medizinischen Gremien und dem Parlament sollte auch bei uns ermöglicht werden. Vielleicht kann der „negative“ Name Selbsthilfe geändert werden – dafür fehlt aber noch eine passende Alternative.
Bezüglich Visionen sollte im Jahr 2030 jeder über SHG Bescheid wissen. Man könnte dieses Thema auch in den Lehrplan von Schulen aufnehmen. Die Basisfinanzierung müsste problemlos funktionieren, ehrenamtliche Tätigkeiten für die Pension angerechnet und steuerliche Absetzbarkeit eingeführt werden.
Schließlich ging es noch über unsere Wünsche für gemeinschaftliche Stärke. Eigentlich sind wir eine Bereicherung und Entlastung für das Gesundheitssystem. Wir sind in der Lage den wirklichen Wunsch der Patienten an die Öffentlichkeit zu tragen und hoffen, damit bald auf eine Qualitätssteigerung erreichen zu können.
Sigrid Kundela, Generalsekretärin der ÖGSHT






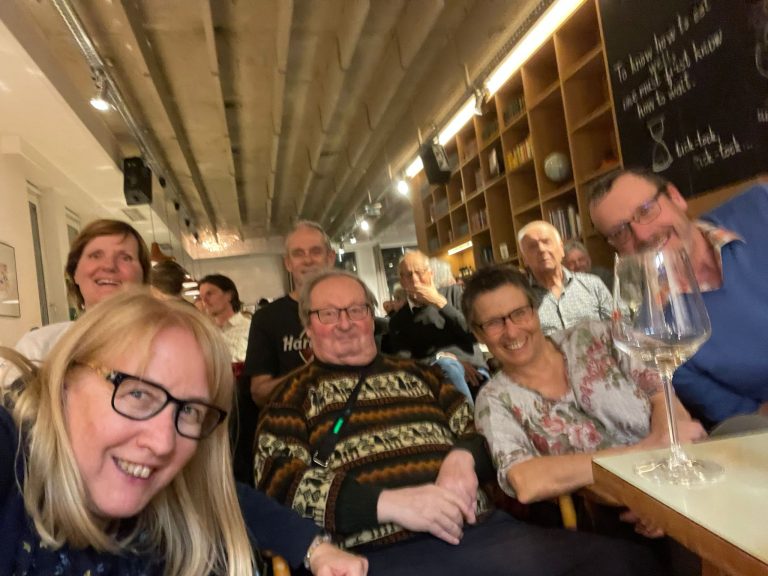












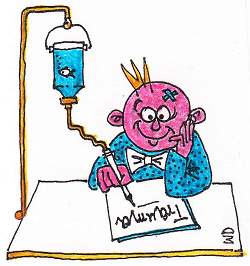
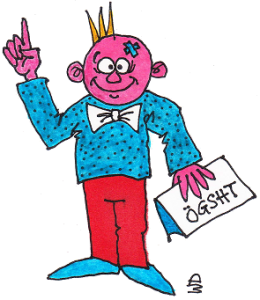



Neueste Kommentare