1. Mein Leben vor dem Unfall
Nach dem Das Leben ist schön. Wir bekommen es geschenkt und können damit machen, was wir wollen. Meist können wir das … oder doch nicht? Lassen Sie mich überlegen, wie es mir bis jetzt ergangen ist.
Vor mittlerweile dreißig (fünfzig) Jahren erblickte ich das Licht der Welt. Wie die meisten anderen Kinder wuchs ich im Kreise meiner Verwandten und Bekannten auf. Nach dem Kindergarten besuchte ich jahrelang die Schule. Mit achtzehn Jahren bekam ich dann mein Maturazeugnis.
Liebend gerne wäre ich Schriftstellerin geworden, aber wer traut sich das in diesem jungen Alter schon zu? Also setzte ich meinen Lerneifer fort, meldete mich für die Fächer Publizistik und Pädagogik an der Universität Wien an und studierte fleißig. Während ich die schriftliche Doktorarbeit über das Thema „Die politische Karikatur in der österreichischen Tages- und Wochenpresse“ verfasste, wünschte ich mir sehr, schon als Journalistin zu arbeiten. Durch viel Glück gelang es mir tatsächlich, in diesem Beruf gleich eine fixe Anstellung zu bekommen. Jeden Tag, jede Woche musste ich in meinen Arbeitscomputer tippen, teletonisch Leute befragen oder zu Pressekonferenzen fahren. Daneben gab es immer noch meine Doktorarbeit, die ich doch nicht ganz verstauben lassen wollte und immer wieder erweiterte.
Neben Studium und Beruf gab es noch genug Freizeit für meine Lieblingsbeschäftigung mit den Pferden. Schon mit sieben Jahren war ich das erste Mal auf einen Pferderücken geklettert. Durch regelmäßiges Training kam ich in dieser Sportart immer weiter. Nicht nur als Reiterin, sondern auch als Voltigierlehrerin war ich tätig. Für eine Gruppe am Pferderücken turnender Kinder und Jugendlicher kaufte ich ein eigenes Pferd. Jeden Tag musste ich nach der Arbeit in den Reitstall fahren, um das Pferd zu bewegen.
Ein Urlaub ohne Hektik stand aus all diesen Gründen schon lange nicht mehr auf meinem Programm. Auch am 23. Juni 1992 war ich nach der Trainingsstunde mit meinem Pferd auf der Heimfahrt in meine eigene Wohnung. Vielleicht war ich auch zu dieser fortgeschrittenen Stunde noch irgendwo eingeladen oder es war ein Treffen ausgemacht. – Ganz egal warum und wieso, ich war wie viele andere Menschen mit meinem Auto unterwegs. Ein Auto hatte ich für meine zahlreichen Tätigkeiten notwendig gebraucht, denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln war das Weiterkommen sehr zeitraubend und auch nicht billig. Für den Preis einer Monatskarte konnte ich mein Auto volltanken. So war ich froh, dass mein altes Auto verlässlich fuhr und ein neuer Wagen schon bestellt, ja sogar bezahlt war und an einem der nächsten Tage geliefert werden sollte.
An dem bereits erwähnten Tag, der mein bisheriges Leben verändern sollte, war es trotz abendlicher Stunde noch sehr warm und hell. Auf der Nach-Hause-Fahrt, die ich mehr als gut kannte, ging es von Pressbaum entlang der Bundesstraße zum westlichen Stadtrand Wiens. Dort bog ich links zum Schottenhof ab. Vorbei an der Fuchs-Villa und dem Campingplatz folgte ich der Hauptstraße den Berg hinauf zum Schottenhof.
Ab da dürfte man 100 km/h fahren, da man sich schon außerhalb des Ortsgebietes von Wien befindet. Damit aber ja keiner zum Raser wird, begrenzt ein 60 km/h-Schild die Geschwindigkeit auf dieser Strecke.
Mit kaum mehr als 60 km/h, wenn überhaupt so schnell, fuhr ich vorschriftsmäßig angegurtet den Hügel hinauf. Zwei Autos waren vor mir, als plötzlich ein lauter Knall – sogar ein extrem lauter Knall – zu hören war.
Ich kann mich an dieses explosionsartige Geräusch überhaupt nicht erinnern. Wahrscheinlich hatte ich es gar nicht bewusst wahrgenommen. Es fehlt mir jegliche Erinnerung daran.
Autofahrer, die Zeugen des Unfalls wurden, berichteten mir später, was passiert war. Sie, liebe Leser, können meine Geschichte wahrscheinlich sogleich verstehen. Ich aber hatte lange gebraucht, bis ich alle Einzelheiten meines Unfalls begriffen hatte.
2. Die Unterbrechung
Ja, es stimmt. Es gab wirklich einen Knall, einen sehr lauten Knall. Dummerweise war ich sogar selbst daran beteiligt. Laut Schilderungen meiner neuen Freundin Karin, die zwei Autos vor mir gefahren war, kam es zum Zusammenstoß meines Autos mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, dessen Lenker die Gewalt über seinen PKW verloren hatte. Der Fahrer war ein junger Bursche, um die 20 Jahre alt, ein eher „halbstarker“ Typ, frisch verheiratet, Vater einiger Kinder und begeisterter „Straßenverkehr-Rennfahrer“ (im Straßenverkehr).
Dieser Autorowdy hatte sich schon in der Vergangenheit nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten und nicht einmal auffällig angebrachte Radaranlagen ließen ihn langsamer fahren. Deshalb waren der örtlichen Polizei bekannt. Eine Anzeige mehr oder weniger war dem verrückten Raser wohl völlig egal.
An diesem Dienstag fuhr er mit 130 km/h – dies zeigte die steckengebliebene Tachometernadel seines Autos an – über die Anhöhe, am Schottenhof vorbei, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen ließ sich nicht mehr dirigieren, rutschte immer mehr zur Straßenmitte und gelangte auf die gegenüberliegende Spur, die eigentlich für die entgegenfahrenden Autos gedacht war. Es blieb keine Zeit zum Überlegen und Handeln. Es gelang mir leider nicht, dem entgegenkommenden Raser auszuweichen. Vielleicht hatte ich so fest wie möglich mit dem rechten Fuß auf das Bremspedal gedrückt. Vielleicht auch nicht. Es ist alles so schnell gegangen und leider existiert für mich keine Erinnerung daran. Sicher ist nur, dass sich mein eigenes Auto mit der Schnauze in die Beifahrerseite des den Unfall verursachenden Fahrzeuges gebohrt hatte. Mein Auto wurde um 180° Grad gedreht und kam zum Stillstand, das Gefährt des Rasers rutschte in den Wald weiter und wurde erst später durch einen Baum gestoppt.
Der unüberhörbare Knall, den ich Ihnen schon beschrieben habe, war durch den ungeheuren, starken Zusammenprall unserer beiden Autos entstanden. Sie sahen aus wie zwei zerdrückte Blechtrommeln.
3. Andere Transportmöglichkeiten
Nach dem Knall wurde es wieder ruhig und still, erzählte mir Karin, die vor mir gefahren war, erste Hilfe leistete und später meine Freundin wurde. Mein Auto stand nunmehr bergab. Karin und Christian, die vor mir gefahren waren, blieben gleich am Straßenrand stehen. Karin sprang sofort aus ihrem Auto und lief zu uns Unfallopfern. Christian blieb ziemlich erschrocken noch ein bisschen geschockt in seinem Auto sitzen. Ein Radfahrer, der den Unfall beobachtet hatte, versprach Karin, dass er im Gasthaus am Fuße des Hügels Polizei und Rettung verständigen werde. (Damals gab es noch kein Handy!)
Es musste wirklich schlimm ausgesehen haben. Wie wäre er sonst auf die Idee gekommen, die Notrufdienste zu alarmieren? (Die Straße wurden von der Polizei bis Mitternacht für den Verkehr gesperrt.)
In acht Minuten war die Rettung am Unfallort. Ein Arzt versuchte sich ein Bild über unsere Verletzungen zu machen. Puls, Atmung, Bewusstseinslage, Hinweise auf Knochenbrüche und Wirbelsäulenfunktion hat er wahrscheinlich überprüft. Dann wurde ich behutsam aus meinem Auto herausgehoben und auf die Liege im Rettungsauto, nein Ambulanzwagen hatte es geheißen, gelegt.
Mein Kopf war ein wenig zerdrückt, und ich blutete im Gesichtsbereich. Irgendwie hatte ich dem Arzt nicht gefallen. Deshalb rief er beim „Martin“-Team an und bat dieses, mich ins Krankenhaus zu bringen.
„Martin“, leider war er immer noch nicht überall bekannt, war der schnellste, netteste und hübscheste Transporter für alle Kranken und Verletzten. Die Rede ist dabei von einem Rettungshubschrauber. Elegant dunkelblau war er gefärbt, und damit man ihn vom ebenfalls blauen Verkehrshubschrauber unterscheiden konnte, hatte „Martin“, der Rettungshubschrauber, Haube, Nase und Flügel rosarot bemalt. (Heute hat der ÖAMTC-Christophorus in ganz Österreich diese Aufgabe übernommen.)
„Martin“ und seine Crew, ein Pilot, eine Ärztin und ein Sanitäter, waren sofort zur Stelle. Nach der Landung am Fuße des Unfallhügels packte man mich in den Hubschrauber und flog mich ins Allgemeine Krankenhaus (AKH).
Flott ging die Reise. Leider fehlt mir auch darüber vollständig die Erinnerung. Am Flug in Richtung Krankenhaus kamen wir auch bei unserer Kirche und dem Pfarrsaal vorbei. Die Probe vom Kirchenchor, den mein Vater leitete, war gerade aus und der rasch vorbeifliegende „Martin“ fiel der ganzen Gruppe auf. Wäre ich bei Bewusstsein gewesen, hätte ich sicher gerne meiner Familie und meinen Freunden aus der Luft zugewunken. Gott sei Dank konnten sie mich nicht sehen. Wer weiß, wie erschrocken meine Eltern gewesen wären und welche unnötigen Sorgen sie sich gemacht hätten.
„Martin“ war nicht langsam unterwegs. In der Luft gibt es keine Ampeln und kaum Verkehr. Ein Folgetonhorn war somit nicht notwendig. Während man als rücksichtsvoller Autofahrer von der Unfallstelle in das Allgemeine Krankenhaus eine halbe Stunde brauchen würde, könnte es der Rettungshubschrauber „Martin“ vielleicht in der halben Zeit, also in einer Viertelstunde schaffen, denkt man. Doch weit gefehlt! Mit Start- und Landezeit hatte „Martin“ diese Strecke in drei Minuten bewältigt.
4. Ein Arzt nach dem anderen
So wie alle anderen Menschen, die nach einem Unfall in ein Krankenhaus kommen, wurde ich vorerst durchuntersucht. Ein Patient, der mit einem Rettungshubschrauber eingeliefert wird, ist jedoch ein besonderer Fall.
Da ich bewusstlos war, konnte ich keine Auskunft über meine Beschwerden geben. Deshalb wurde mein ganzer Körper untersucht. Von oben bis unten wurde ich durch den Röntgenapparat geschickt. Dann wurde eine CT, ganz korrekt ausgedrückt eine Computer-Tomografie des Kopfes und des Gesichtsschädels gemacht. Sicher wurde von einem Facharzt für Radiologie ein Ultraschall der Bauchorgane durchgeführt, um innere Blutungen auszuschließen.
Eine Weile werden die vielen Untersuchungen schon gedauert haben. Spezialisten der verschiedensten Fachrichtungen wie Chirurgen, Internisten, Neurologen, Anästhesisten hatten mich wohl untersucht, um ja keine Verletzung zu übersehen. Letztendlich fand man aber heraus, dass nur mein Kopf in Mitleidenschaft gezogen worden war. Man diagnostizierte ein offenes Schädelhirntrauma mit einer Schädelbasisfraktur, Brüche der rechten Stirnhälfte und des rechten Augenhöhlendaches. Also wurden Kiefer- und Gesichtschirurgen, Spezialisten für solche Verletzungen hinzugezogen, um mich wieder zusammenzuflicken.
Die nun hinzugezogenen Kiefer- und Gesichtschirurgen hatten aber nicht nur oberflächlich die zerrissene Haut zusammengenäht, sondern auch eine komplizierte Fraktur des Stirnbeines operiert. Dies verstand ich allerdings erst viel später. Monate danach brachte mich meine Mutti einige Male zu dieser, damals noch im alten AKH gelegenen Ambulanz der Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie. Damals wurden Kontrollröntgenbilder der Augenhöhle angefertigt. Auch ich hatte diese Röntgenbilder gesehen und siehe da, es war wirklich eine Meisterleistung, die der Chirurg damals in der Nacht mit meinem Kopf geschaffen hatte. Sieht man von außen gar nicht, wie wertvoll ich geworden war?! Meine Stirn wurde mit 42 Schrauben und mehreren Platten (10 Stück) verschönert.
Der Grund für die Verplattung war allerdings nicht ästhetischer Natur. Vielmehr hatte der Druck, den das Autolenkrad bei dem Unfall verursacht hatte, das Stirnbein gebrochen. Mit kleinen Schrauben aus einem wertvollen Edelmetall (Titan) konnte man die übliche Form wieder herstellen. Niemand sieht mir jetzt an, wie zerbrochen mein Kopf damals war. Jedoch sieht auch niemand, wie wertvoll ich durch die vielen Schrauben und Platten gemacht wurde. (2006 war eine Nachoperation zur Entfernung einer aus einem im Kopf verbliebenen Knochensplitter entstandenen Zyste – Mukozele – erforderlich, bei der einige Schrauben und 8 Platten entfernt, dafür aber ein Kanal zur besseren Flüssigkeitszirkulation in der Augenhöhle eingesetzt wurde.)
Angeblich vier oder sogar fünf Stunden hatte die Operation gedauert. So einfach und flott ging das Zusammenschrauben von Knochensplittern eben nicht. Nach der Operation wurde noch ein Kontrollröntgen gemacht, um zu überprüfen, ob die verschraubten Knochen genau zusammenpassten. So vorbildlich war die Arbeit des Chirurgen geworden, dass eine Beschreibung des Operationsvorganges in das Skriptum für Medizinstudenten aufgenommen wurde.
Wie aus den medizinischen Untersuchungen hervorging, lag ich zwei Tage im Koma. Was soll das nun wieder bedeuten? Ein medizinisches Lexikon verrät, dass das Koma, auch mit „c“ also „Coma“ geschrieben, einer tiefen Bewusstlosigkeit mit verminderten Reflexen im Bereich des Hirnstamms entspricht. Mitunter setzen auch innere Organe aus. Bei mir kam es zu einem Atemstillstand. Dies bedeutet, dass ich künstlich beatmet werden musste. Dazu wurde ein Schlauch durch die Nase in die Luftröhre eingeführt, um künstlich Luft in die Lunge zu pressen.
Zwei Tage hatte mein Körper gebraucht, um aus diesem Koma aufzuwachen. Sobald ich dann aber wieder munter wurde, war ich sehr unruhig und verwirrt. Von dem Unfall und seinen Folgen hatte ich keine Ahnung. Auch von den Schmerzen, die man nach so einer Schädelverletzung haben müsste, bekam ich, vollgestopft mit unzähligen Schmerzmitteln, wenig mit.
Damals, am 23. Juni, genau genommen war es schon am 24. Juni in der Früh, wurde ich nach der Operation auf die Intensivstation gebracht. Das ist kein übliches Krankenzimmer. Man liegt zwar auch in einem Bett, sogar den ganzen Tag hindurch, aber nicht nur Arzt und Pfleger leisten dem Patienten Gesellschaft. Neben dem Bett stehen etliche Maschinen, die mit Schläuchen und Kabeln mit dem Patienten verbunden sind. Diese dienen sowohl der Ernährung als auch der Überwachung des Patienten.
Soviel ich von den Erzählungen meiner Freunde und den behandelnden Ärzten erfahren hatte, klebten drei Elektroden auf meiner Brust, die kontinuierlich das EKG aufzeichneten. Weiters war da noch ein Harnkatheder, der mir das Aufsuchen einer Toilette ersparte. Am Arm hing dann noch ein Schlauch, der, wie von den Experten fachmännisch bezeichnet, Infusionskanüle genannt wird. Durch diesen Zugang wurden mir Flüssigkeiten zur Ernährung und Medikamente zugeführt.
Wahrlich lange Zeit hing ich an diesem „Speise-Schlauch“. Oft musste der venöse Zugang an meinem Arm an einer anderen Stelle erneuert werden. Als dann eines Tages kein verfügbarer Platz mehr am Arm gefunden wurde, kam der Hals an die Reihe. Dies nennt man zentralvenösen Zugang. Schrecklich musste diese spezielle Körperverbindung ausgesehen haben. Besucher, die das erleben mussten, tun mir heute noch leid und ich bin froh, dass ich das nicht sehen musste.
Das Pflegepersonal der Intensivstation war rund um die Uhr mit mir beschäftigt. Ständig wurden Messergebnisse an den oben beschriebenen Maschinen abgelesen und alle Werte in einen speziellen Computer eingegeben. Oft hatte das Tonsignal vom Überwachungsgerät sich bei meinem Messkasten deshalb gemeldet, weil es mir wieder gelungen war, eine dieser Elektroden loszureißen. Warum und wieso ich mich gegen diese schmerzlosen Messgeräte gewehrt hatte, kann ich wirklich nicht verstehen. Für die Krankenschwestern musste es lästig gewesen sein, diese Elektroden immer wieder auf meine Brust kleben zu müssen. Dass ich nackt unter der Bettdecke gelegen war, hatte diese Aktion sicherlich vereinfacht. Viel einfacher war es aber noch, mich zu „fesseln“. Ein anderes passendes Wort dafür fällt mir gar nicht ein. Gemeint sind damit zwei gepolsterte Hand- und Fußgelenksbänder, die dort ein bei den Armen und Beinen angebunden und am Bettrand befestigt wurde, um zu verhindern, dass ich ständig venöse Zugänge und Überwachungsinstrumente entfernte.
So angehängt, hätte ich Tag und Nacht ruhig am Rücken liegenbleiben sollen. Nur ein oder zwei Stunden pro Tag durfte ich, mit einem hübschen Spitalsnachthemd bekleidet, auf einem großen Sessel sitzen. Das empfand ich aber als ein sehr geringes Angebot. Also versuchte ich selbst die Fixierungen zu beseitigen. Auch so gefesselt, war es mir möglich, mich wie früher daheim auf den Bauch zu legen. Dass daraufhin die Überwachungsinstrumente verrücktspielten, war eher ein Problem für Krankenschwestern und Pfleger.
Wie sehr mir diese Binden auf die Nerven gingen, bekam auch jeder Besucher von mir zu hören. Liebevoll nannte ich diese Fixierungen immer „Flügerln“ und teilte auch jedem mit, dass diese Dinge weg müssten. Wenn meine Besucher versprachen, auf mich und die medizinischen Messschläuche aufzupassen, wurde ich jedoch immer „entfesselt“.
Ein Blick in die Krankengeschichte verrät mir, dass ich durch den Unfall verlangsamt und vergesslich geworden war. Diesbezüglich fällt mir ein, dass mir meine Mutti schon einmal berichtet hatte, dass ich mich bei ihr öfter beschwerte, dass ich keinen Besuch bekommen hatte und das genau zwei Minuten nachdem der Besucher gegangen war. Also nicht nur ein bisschen vergesslich war ich, vielmehr war mein ganzes Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt.
Weiters habe ich später erfahren, dass ich viel rascher müde wurde, was kein Wunder war, wenn man bedenkt, wie viel und wie lange ich jeden Tag im Bett gelegen war. Dazu kamen noch meine Seh- und Konzentrationsstörungen. Was das Sehproblem betrifft, kann ich hoffentlich verständlich erklären, dass nicht meine Augen, sondern vielmehr die zentrale Sehbahn dafür verantwortlich war. Die Sehbahn wurde durch den Aufprall in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch bin ich angeblich auf einem Auge sogar eine Zeit lang blind gewesen. Einmal in der Woche, vielleicht auch jeden Tag, war der Augenarzt zu mir auf die Intensivstation gekommen und hatte regelmäßig Augenkoordination und Sehleistung überprüft. Bald stellte man fest, dass ein Teil des rechten Gesichtsfeldes fehlte. Für den Alltag hieß das, dass ich zwar geradeaus alles erkennen konnte, im rechten Gesichtsfeld jedoch immer wieder Dinge übersah. Würde ich wieder Autofahren, hätte ein Rechtskommender bei mir keinen Vorrang, da ich, wie gesagt, alle Sachen die rechts in meinem Gesichtsfeld erschienen, nicht erkannte. Lange Zeit hatten sich die Augenärzte im AKH um meine Augen bemüht. Auch das Fixieren und Erkennen von Buchstaben und Worten war schwierig geworden. Gut eineinhalb Jahre waren die Ärzte bemüht, meine Augen wieder richtig einzustellen. Ich bekam Tropfen, musste zu Therapien, bekam sogar eine Übungsbrille verschrieben, aber nichts brachte den gewünschten Erfolg. Im Laufe der Zeit gewöhnte ich mich daran, dass ich zum Lesen eben länger brauche. Schwierige Texte wurden von mir nur sehr schwer oder gar nicht verstanden. Das Lesen der einzelnen Wörter war eben so schwierig, dass ich den Inhalt des ganzen Satzes nicht verstehen konnte.
Auch mein Gedächtnis, meine Konzentration und Leistungsfähigkeit waren vermindert und sind auch heute noch nicht dort, wo sie vor dem Unfall waren. Sogar zwei Jahre nach dem Unfall, wo ich immer noch ein paar Mal in der Woche zur Ergo-Therapie in das AKH fuhr, um meine kognitiven Leistungen zu trainieren, spürte ich häufig mein Defizit.
Drei Tage nach dem Unfall wurde ich von der Intensivstation der Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie an die Intensivstation der Universitätsklinik für Psychiatrie verlegt. Das war ein schwer verständliches Ereignis. Angeblich ging meine Station, auf der ich bisher gelegen hatte, geschlossen in Urlaub.
In den Unterlagen der neuen Intensivstation fand ich später einige Hinweise über mein Verhalten. Ich war zum Beispiel uneinsichtig für meine Krankheit. Oft fragte ich, warum ich eigentlich in diesem komischen Zimmer sei. Als Antwort bekam ich hunderte Male den Hinweis, dass mir ein verrückter Autofahrer hineingefahren sei und ich daher eine Stirnbeinfraktur hätte. Aha, lautete regelmäßig meine Antwort und ich plauderte über etwas anderes weiter.
Apropos sprechen! War ich einmal munter, dann formte ich nicht nur verständliche Worte und Sätze. Nein, ich erzählte vom ABC und XY. Wahllos setzte ich einzelne Buchstaben zwischen Wörter. Viele Wörter waren aus meinem Gedächtnis verschwunden. Diese leeren Flecken versuchte ich durch Buchstaben und neu gebildete Wörter aufzufüllen. Nur verstehen konnte das niemand.
Interessant finde ich die „englische Phase“. Aus genauso unerklärlichen Gründen wie die Verwendung falscher Wörter und einzelner Buchstaben fing diese fremdsprachliche Episode bei mir an. Aber nicht nur mit ab und zu einem englischen Wort machte ich auf mich aufmerksam. Nein, ausnahmslos sprach ich nur mehr in Englisch. Selbst wenn ich noch so sehr gebeten wurde, wieder Deutsch zu sprechen, es gab keine Chance. Als wäre es meine Muttersprache, plapperte ich ohne Pause und angeblich auch ohne Fehler. Erstaunlich war nur die Tatsache, dass man mir auf Deutsch eine Frage stellen konnte und ich in Englisch antwortete.
Arm war meine Mutter. Jeden Tag war sie bei mir und erzählte mir Geschichten. Was sollte sie aber jetzt machen? So gut war ihr Englisch beim besten Willen nicht, dass sie mit mir englisch hätte reden können. Nicht nur einmal, nein jeden Tag ein paar Mal, bat sie mich und forderte mich auf, deutsch zu sprechen. Kein Erfolg! Englisch war die einzige Sprache, die ich zu diesem Zeitpunkt benützen konnte. Nur gut, dass die Ärzte diese Sprache gut konnten und nach wie vor erfahren konnten, was mir fehlte.
Nicht so lustig, aber nebenbei erfreulich, war die Tatsache, dass ich am Anfang auf der Intensivstation nicht essen konnte. Sicher hatte ich dadurch einige Kilos abgenommen. Nach etwa zwei Wochen waren die Ärzte der Meinung, dass ich wieder essen könnte und nicht mehr nur von der Infusion ernährt werden sollte. Also bekam ich Wasser zum Trinken. Niemand wird sich denken, dass einem so eine einfache Sache schwer fallen könnte. War es aber doch! Ausführlich wurde mir erklärt, wie man etwas schluckt. Ich bekam etwas Wasser in den Mund getröpfelt und … anstelle zu schlucken, begann ich zu kauen. Ein bisschen nass wird das Bettzeug schon geworden sein, bis ich endlich wieder wusste, wie man Wasser schluckt.
Das Essen selbst war vergleichsweise einfacher. Kauen konnte ich gut. Immerhin hatte ich es bei den Trinkübungen schon einige Male probiert. Was mir mehr Schwierigkeiten bereitete, war der Versuch, Gabel und Löffel in den Mund zu bringen. Drei- oder viermal klappte es. Dann ließ meine Kraft nach und ich hätte sicher zum Essen aufgehört, wenn mich nicht jemand gefüttert hätte. Ab dieser Zeit nahm ich dann wieder konstant an Gewicht zu, sodass ich dann letztendlich schwerer als vor dem Unfall war. Obwohl ich natürlich selbst viel gegessen hatte, gebe ich doch ein kleinwenig den Ärzten und ihren Medikamenten die Schuld. Angeblich regen Psychopharmaka auch den Appetit an. Aufgrund meines Unruhezustandes wurde mir weit mehr als nur eine Pille pro Tag verordnet.
Am 25. Juli, also nach fünf Wochen, konnte ich endlich die Intensivstation verlassen. Leider hieß das nicht nach Hause gehen. Nein, ich wurde auf eine andere Abteilung im AKH verlegt. Diesmal war die Abteilung für Neurologische Rehabilitation meine neue Heimat. Auch dort wurde ich wieder untersucht. Immer noch war ich in der Lage, fehlerfrei englisch zu sprechen und da ich von diesem Zeitpunkt an nicht mehr den ganzen Tag im Bett liegen musste, konnte ich meine erzählenden Sätze mimisch unterstreichen. Wie eine Schauspielerin vom Burgtheater sollte ich gewirkt haben. So einfach konnte es wohl für die Ärzte dort nicht gewesen sein, mich zu untersuchen.
Ein Arzt, der mich am ersten Tag in der neuen Station durchuntersuchte und sich dann netterweise immer um mich gekümmert hatte, war Dr. Peter Schnider. Er war der einzige Arzt, den ich deshalb akzeptierte, weil ich ihn für einen Studenten hielt, der an mir üben und lernen musste. So wie eben alle Studenten untereinander Du-sagen, redete auch ich mit dem Herrn Doktor so kollegial. Ob ich aber Schnider oder Peter zu ihm gesagt hatte, weiß ich nicht mehr. Sicher hatte ich es mir wahrscheinlich nie merken können und jedes Mal nach seinem Namen gefragt, denn die kleine Schrift am weißen Ärztekittel war für mich unlesbar. Irgendwann, nach der 20-sten oder 30-sten Erklärung, dass er Schnider, wie Schneider ohne „e“ heiße, hatte ich mir seinen Namen wohl endlich gemerkt.
Sehr ehrlich und mitteilungsbedürftig war ich damals. Die Hinweise bezüglich meiner körperlichen Schwierigkeiten und deren Folgen bekam ich immer wieder erklärt. Die Ärztesprache war mir aber oft zu kompliziert. Bei den Visiten teilte ich dem Arzt mit, dass ich kein Wort verstanden hätte. Also musste er es noch einmal erklären und ich ließ erst locker, nachdem mir alles klar war. Dr. Schnider wusste bald, dass ich ihm sehr ehrlich sagen würde, ob ich ihn verstanden hätte. Also gewöhnte er sich an, gleich nach ein paar Sätzen nachzufragen, ob ich auch alles mitbekommen hatte.
Die beiden Spitalswochen auf der neurologischen Abteilung waren gefüllt mit Spezialuntersuchungen und verschiedenen Therapien. Zunächst kam eine Logopädin zu mir ins Patientenzimmer. Damit wir mehr Ruhe beim Arbeiten hätten, lud sie mich in ihr Zimmer ein. So einer netten Einladung kam ich gerne nach. Wie früher im Büro saß ich dort an einem Schreibtisch. Zunächst musste ich mir Bilder anschauen und erklären, was darauf zu sehen war. Lange nahm ich mir nicht Zeit zum Überlegen. Auf der Zeichnung, wo ein Tisch zu sehen war, meinte ich, es wäre ein Apfel. Die Darstellung eines Sofas bezeichnete ich als Österreich.
Das nächste Mal musste ich vier Bilder in der richtigen Reihenfolge ordnen und danach eine Geschichte darüber erzählen. Angeblich hatte es lange gedauert, bis die richtige Reihenfolge der Bilder einen Sinn ergaben. Dann sollte ich die Geschichte schreiben. Sehr verändert war meine Handschrift damals. Vielleicht war mir das Schreiben mit dem Stift schwer gefallen oder war ich wirklich noch so verwirrt, dass die meisten Sätze nicht vollständig waren und keinen Sinn ergaben.
Da ein Logopäde aber vor allem für die Bezeichnung von Sprachstörungen zuständig ist, plauderte diese Therapeutin viel mit mir. Ich war zwar sehr gesprächig, aber alles andere als leicht verständlich. Nur wenn ich schlecht aufgelegt war, bekam sie gleich mit. Deshalb hielt sie mich auch nicht mit Gewalt zurück, wenn ich es bevorzugte, wieder zurück in mein Zimmer zu gehen.
Für mich war diese Tätigkeit leicht. Viel schwerer muss es der Therapeutin und den Ärzten gegangen sein, herauszufinden, warum ich wirklich so viele Fehler machte.
Zusätzlich wurde noch eine Ergo-Therapeutin zu mir geschickt. Diese Dame war wirklich arm und sie tut mir heute noch leid (wenn ich nur wüsste, welche Dame das damals gewesen war). Ich ließ mich überhaupt nicht von der Notwendigkeit einer Therapie überzeugen. Eigentlich sollte sie meine handwerklichen und geistigen Fähigkeiten fördern. Ich verstand den Sinn dieser Therapie aber überhaupt nicht und lehnte sie ab, in dem ich einfach die Zimmertüre zuschlug.
Seitdem ich nicht mehr auf der Intensivstation lag, musste ich selbst zu den entsprechenden Ambulanzen für die geforderten Untersuchungen gehen. Meine Mutter begleitete mich oft. Viel zu verwirrt und ungeordnet war ich damals noch und hätte das passende Haus und richtige Stockwerk wohl nie gefunden.
Große Lust zu diesen Untersuchungen hatte ich jedoch nie. Immer wieder fielen mir etliche Ausreden ein oder ich blieb aus Protest einfach in meinem Bett liegen. Ich war überhaupt nicht in der Lage, den Sinn der ganzen medizinischen Tätigkeiten zu verstehen. An den Autounfall konnte und wollte ich immer noch nicht glauben. Schließlich war ich laut meiner eigenen Aussage nur den Studenten zuliebe im Spital und stellte mich für ihre Übungen zur Verfügung. Dass mein Fall damals so viele Ärzte zu meinem Patientenbett gelockt hatte, kann mich jetzt – viele Monate später – freuen. Ich war eben damals „Miss-AKH“.
5. So haben es meine Eltern und Freunde erfahren
Die Ärzte im Allgemeinen Krankenhaus, kurz AKH genannt, wussten nun, was mit mir los war. Wie war das aber bei meinen Verwandten und Bekannten? Woher hatten sie erfahren, was passiert war?
Als Erste wurden meine Eltern benachrichtigt. So gegen Mitternacht läutete das Telefon. Die beiden lagen schon im Bett und wunderten sich natürlich, wer noch so spät bei ihnen anrief. Ein Polizeibeamter meldete sich und fragte, ob sie zufällig Sigrid Kundela kannten. Papa bejahte die Frage und teilte ihm mit, dass ich seine Tochter wäre. Daraufhin sagte ihm der Anrufer, dass ich in einen schweren Autounfall verwickelt war und mich ein Hubschrauber in das AKH gebracht hätte. Etwas Genaueres wisse er aber leider nicht. Verständlicherweise wollten meine Eltern mehr wissen. So fuhren sie ins Spital.
Der Weg zur Unfallaufnahme war leicht zu finden. Dort angekommen, wurde der zuständige Schalterbeamte gefragt, wo die verunfallte Tochter, also wo Sigrid Kundela sei. Sigrid Kundela? Alle Unterlagen wurden durchgeblättert, aber mein Name stand auf keinem Blatt. „Das gibt es doch nicht“, meinten meine Eltern. „Sie hatte doch einen schweren Autounfall und wurde mit dem Hubschrauber hier hergebracht“, erklärten sie. „Ach so, mit dem Hubschrauber,“ nickte der Portier wissentlich. Man habe bisher den Namen der Patientin, die mit dem Hubschrauber eingeliefert worden war, nicht gekannt. Deshalb schien mein Name auch nicht auf der offiziellen Liste auf. Meinen Eltern wurde mitgeteilt, dass ich nach der Erstversorgung auf die Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie transportiert worden sei.
Also wanderten meine Eltern zu dieser Abteilung. Dort angekommen, wurde ihnen gleich von einem Arzt mitgeteilt, dass ich einen Knochenbruch im Bereich der Stirn hätte, allerdings nicht lebensgefährlich verletzt worden sei. Eine Notoperation war geplant, deshalb könnte ich auch nicht mehr besucht werden. Gott sei Dank, denke ich mir im Nachhinein. Wer weiß, wie hässlich und entstellt ich damals ausgesehen hatte?
So hatten meine Eltern erfahren, was passierte. Sie waren freilich auch die Einzigen, die offiziell informiert werden mussten. Irgendein Gesetz wird das wahrscheinlich so verlangen. Wie hatten es aber alle anderen Verwandten und Bekannten erfahren?
Für solche Meldungen gibt es Zeitungen, Radio und Fernsehen. (Damals noch kein Internet!) Bei den elektronischen Nachrichtensendungen geht es zeitlich gesehen natürlich am schnellsten. So war schon in der „Zeit im Bild“-Sendung, kurz vor oder nach Mitternacht, also gleich wenige Stunden nach dem Unfall ein Bericht gekommen. Die zertrümmerten Autos und der Rettungswagen waren zu sehen. Dann wurde ein Schwerverletzter auf der Bahre liegend gezeigt. Ob es sich dabei um den jungen Raser oder um mich gehandelt hatte, war beim besten Willen nicht auszumachen. Aber ganz egal wer es war, Namen wurden keine genannt. So ein silbergraues Auto, wie damals das meine, kann auch jeder Mensch gefahren haben. Noch dazu wurde von zwei männlichen Fahrern gesprochen. Wer hätte dabei schon an mich gedacht? Einige Freunde hatten damals die Nachrichten gesehen, sich auch an das Auto erinnert, aber im Entferntesten nicht daran gedacht, dass ich in diesen Unfall verwickelt war.
Mehr Informationen gab es in den Nachrichtenblättern. Am Tag darauf, also am Mittwoch, schaffte es nur eine einzige Tageszeitung, über diesen Unfall zu berichten. So stand es damals geschrieben:

Leider wurde ich in diesem Zeitungsartikel für tot erklärt. Die Meldung war erschreckend. Es hieß, dass ich namentlich erwähnt, diesen Unfall nicht überlebt hätte. Im Nachhinein betrachtet, kann man das sogar ein bisschen originell finden. Ich hatte mein altes Leben stehen gelassen, ein Neues hatte begonnen. Das klingt schon sehr prophetisch und ändert nichts an der Tatsache, dass mich einige Freundinnen und Freunde für tot hielten.
Am nächsten Tag, als schon am Donnerstag, dem 25. Juni, brachte die Zeitung noch einmal einen Beitrag über den gleichen Unfall. Diesmal mit dem Hinweis, dass ich doch nicht verstorben sei.

So oder so ähnlich war die Nachricht an diesem Tag auch in vielen andern Tageszeitungen zu lesen.


Täglich Alles am 25.6.1992
Mit 130 durch Wien: Freundin tot
Unfassbar! Ein 22jähriger raste mit Tempo 130 durch Wien. Jetzt hat Gerhard M. seine Freundin auf dem Gewissen. Sein Auto kam ins Schleudern, knallte gegen einen Pkw.
Dienstag abend. Amundsenstraße Richtung Hütteldorferstraße im 14. Bezirk. Der Automechanikerlehrling Gerhard M. ist mit seiner Freundin unterwegs nach Hause. Er gibt Vollgas. Mit 130 km/h jagt er seinen BMW stadteinwärts.
Plötzlich kommt sein Auto ins Schleudern, gerät auf die Gegenfahrbahn, knallt frontal gegen einen VW-Jetta. Der BMW fliegt durch die Luft, kracht gegen einen Baum. Alice V., 18, überlebt den Aufprall nicht, stirbt an der Unfallstelle, Gerhard M. wird schwer verletzt. Die Lenkerin des VW, „Ganze Woche“-Redakteurin Sigrid Kundela, 28, erleidet einen Kieferbruch. Aber zum Glück: Sie lebt! Ist nicht verstorben, wie andere Zeitungen behaupteten.
Viele hatten von dem Unfall durch eine dieser Meldungen erfahren. Da man die Sache nicht so recht glauben konnte oder besser gesagt, nicht glauben wollte, rief man bei meinen Eltern an. Dort hoffte man, die ganze Wahrheit zu erfahren.
Rund um die Uhr hatte das Telefon bei meinen Eltern geläutet. Was wirklich mit mir passiert sei, ob ich noch lebe oder nur der Kiefer gebrochen sei? Mit solchen Fragen wurden meine Eltern ständig konfrontiert.
Aber nicht alle Menschen lesen jeden Tag die Zeitung. Zu diesen Leuten gehört zum Beispiel meine Freundin Gesa, eine Schauspielerin. Wir hatten uns für Mittwoch abends ein Treffen ausgemacht. Dass es sich dabei um den Tag nach dem Unfall drehte, wussten wir bei der Terminbesprechung natürlich noch nicht. Sicherheitshalber wollte mich Gesa an diesem Tag in der Arbeit anrufen, ob es bei dem ausgemachten Treffen bleiben würde. Also rief sie bei mir im Büro an. Da sie meine Durchwahlnummer kannte, hatte ich gewöhnlich persönlich abgehoben. An diesem Tag meldete sich aber ein Kollege. „Nein, die Frau Kundela ist nicht da“, wurde Gesa mitgeteilt. Zu Hause war ich auch nicht zu erreichen. Also probierte sie es ein bisschen später noch einmal in meinem Büro. Ich war aber immer noch nicht da, hieß es und wer sie denn überhaupt sei, wollte der Arbeitskollege wissen. Nachdem Gesa mitteilte, dass sie meine Freundin sei, wurde ihr die ganze Wahrheit, soweit man sie bereits wusste, mitgeteilt. Auch Gesa holte sich dann bei meinen Eltern weitere Informationen.
Fritz, mein Ex-Freund, mit dem ich wegen des Pferdesports noch immer Kontakt hatte, wurde gleich am Mittwoch in der Früh von meiner Mutter angerufen. Wieviel ich in letzter Zeit mit Fritz gestritten hatte, wusste meine Mutter natürlich nicht. Deshalb informierte sie Fritz von meinem Unfall und den Folgen und fragte ihn, ob er alleine das Training mit der Voltigiergruppe (=Kinder, die am Pferderücken turnen) machen konnte. Wer würde sich da schon trauen meiner verwirrten Mutter abzusagen? Fritz stimmte dem Solotrainerdasein zu und erzählte die Unfallgeschichte ein paar Freunden. (Fritz ist immer noch Trainer der Voltigiergruppe, allerdings mittlerweile in einen anderen Stall mit der Gruppe trainiert und national sowie auch international sehr erfolgreich.)
Unter anderem erfuhr es Manfred, der mich auch gut kannte. Er hatte von dem schweren Unfall schon in den Abendnachrichten im Fernsehen erfahren. Wie gesagt, wurden dabei aber keine Namen genannt. Nur das eine zerquetschte Auto in silbergrau war ihm sehr bekannt vorgekommen. Dass es aber wirklich mein Fahrzeug war, darauf kam er nicht.
Am nächsten Tag, also bereits am Donnerstag, kam der Vater von Manfred zufällig bei den total beschädigten Autos an der Unfallstelle vorbei. Nach der Arbeit daheim angekommen, teilte er seiner Familie mit, dass er zwei so arg beschädigte Autos gesehen hätte und dort sicher niemand mehr lebend herausgekommen sei. Auch Manfred war an diesem Tag bei seinen Eltern auf Besuch. Er teilte seinem Vater mit, dass doch noch jemand aus dem auffällig verformten Auto gekommen sei. Diese Meldung hatte seine Eltern natürlich erschreckt, da sie mich bei Sportveranstaltungen oder Partys schon persönlich kennengelernt hatten.
Am Samstag nach meinem Unfall stand ein Klassentreffen am Programm. Das Zehn-Jahre-Maturatreffen war der Anlass für die geplante Feier. Vor so langer Zeit war der letzte Schultag gewesen. Natürlich wollte ich, wie die meisten ehemaligen Schulkolleginnen zu diesem Treffen gehen. Auch meine Schulfreundin Isabella hatte es vor. Genauso wie viele andere hatte sie von meinem Unfall aus der Zeitung erfahren. Ihre Eltern, die mich von der Schulzeit her noch sehr gut kannten, hatte sogar zufällig einen, nein zwei laute Knaller gehört, als sie ganz in der Nähe der Unfallstelle in ihrem Garten waren. Dann kam der Hubschrauber zwei Mal. Dass es sich bei einem Opfer aber um mich gehandelt hatte, wussten sie vorerst nicht.
Isabella hatte von dem Unfall aus einer Zeitung erfahren und gleich bei meinen Eltern nähere Informationen eingeholt. Sie und meine ehemalige Mathematiklehrerin, deren Tochter von meiner Mutter beaufsichtigt worden war und die somit in Kontakt mit meiner Familie stand, konnten bei der Maturafeier über meinen Unfall viel besser Auskunft geben als alle anderen Mitschülerinnen. Die meisten hatten davon in einer der vielen Zeitungen gelesen. Sogar für tot hatten mich einige gehalten. Wie erleichtert waren sie, als sie erfuhren, dass ich doch noch lebe.
Auf besondere Weise erfuhr es Margit, meine Bregenzer Freundin. Sie bekam einen Brief von meiner Mutter. Das machte Margit schon unruhig, denn natürlich hatte sie noch nie Post von meiner Frau Mama erhalten. In ihrem Schreiben schilderte Mutti ganz genau, was passiert war und was die Ärzte nun vor hatten. So wie allen anderen tat ich Margit sehr leid.
Wenig Mitleid, genau genommen gar kein Mitleid hatten alle mit dem verrückten Rowdy, der den Unfall verursacht hatte. Dabei könnte man ihn, der später durch die Unfallfolgen ums Leben kam und seine Familie genauso bedauern.
Auf irgendeine Art und Weise hatte jeder Mensch, der mich kannte, von diesem Ereignis und seinen Folgen erfahren. Wer immer etwas davon hörte, hatte es weitererzählt. Also brauche ich in diesem Buch nicht mehr über den Unfall berichten. Vielmehr geht es mir darum, die für mich und meine Familie schwierige Zeit nach dem Unfall zu schildern. Der wochenlange Krankenhausaufenthalt, das Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit, das langsame begreifen, was eigentlich passiert war, die Zeit nach der Entlassung, berufliche Wiedereingliederung …
6. Besuche in meinem neuen Heim
Manche Freunde, die von meinem Unfall durch die Nachrichten etwas gesehen, gehört oder gelesen hatten, wollten mich im Spital besuchen. Aber nicht nur die Freunde, auch neugierige Journalisten wollten erfahren, was am Vorabend wirklich passiert war. Aber keine Chance, weder Freunde, noch berufliche Besucher drangen bis zu mir vor. Die Krankenschwestern verboten den Zutritt in die Intensivstation.
Warum und wieso keiner zu mir durfte, wurde gar nicht erklärt. Extrem Neugierige bekamen den Hinweis, dass ich noch bewusstlos sei. Also hätte ich ohnehin mit keinem Besucher plaudern können.
Außer meinen Eltern hatte es am ersten Tag niemand geschafft, mich zu sehen. Glücklicherweise, denn meinen Anblick zu ertragen, darum wäre niemand zu beneiden gewesen. So wie Mutti meinen damaligen Zustand schilderte, tun sie und Papa mir sehr leid, das mitgemacht zu haben.
Seitdem bin ich mir ganz sicher, dass ich nie ein eigenes Kind haben möchte. Diese Vorstellung, hilflos vor einem leidenden Menschen, der einem sehr viel wert ist, zu stehen, versetzt mich in einen derartigen Schrecken, dass ich mir diesen Schock ersparen möchte.
Gleich am ersten Tag waren meine Eltern über Verletzung und voraussichtliche Prognose aufgeklärt worden. Obwohl ich noch beatmet wurde und somit nicht ansprechbar war, wurde mitgeteilt, dass ich sicher überleben werde, vorausgesetzt dass ich keine Infektion bekäme. Mutti beruhigte diese Aussage schon sehr, sie streichelte mich, obwohl mein Geist weit entfernt war.
Weniger glücklich war Papa. Er sah mich vom Zimmereingang aus an der Beatmungsmaschine und an vielen Schläuchen hängend. Dieser Anblick hatte ihn sehr beunruhigt. Obwohl auch er jeden Tag auf Besuch kam, verbrachte er mehr Zeit im hauseigenen Cafe-Restaurant und rauchte dort eine Zigarette nach der anderen. Auch vor meinem Zimmer stand er öfter Luft schnappend und schilderte vielen anderen Besuchern meinen Unfall. Erst nach ein paar Wochen traute er sich mit mir zu plaudern. Ich bezweifle nur, dass wir gegenseitig viel voneinander verstanden hatten. Nur über den Handkuss wussten wir beide bald Bescheid – es war die übliche Begrüßung meines Vaters. Bei jedem Kommen und Gehen küsste er freundlich meinen Handrücken.
Übrigens hatte Papa während dieser Zeit auch Geburtstag gehabt. Zu diesem Anlass schenkte ich ihm ein neues Ausweistascherln. Er bekam es von mir überreicht, besorgt und verpackt hatte es natürlich Mutti. Viel schöner als Glückwünsche und Geschenkübergaben fand ich den anschließenden Ausflug in das Spitalscafe „Clinicum“. Es war zu jener Zeit als ich schon in die Abteilung für neurologische Rehabilitation der Universitätsklinik verlegt worden war und mit ärztlicher Erlaubnis jeden Tag in das Kaffeehaus gehen durfte und wollte.
Aus medizinischer Sicht waren Muttis Besuche viel „intensiver“. Das heißt, sie unterstützte die Krankenschwestern so gut wie möglich. Jeden Tag saß sie neben mir, Händchen haltend und Geschichten erzählend. Wie ein Baby wurde ich von ihr gefüttert. Da fällt mir ein, dass ich damals angeblich alles gegessen hatte. Sogar bei Tomaten und Rosinen zeigte ich keine Ablehnung, obwohl ich das früher nie leiden konnte und auch jetzt nicht mehr essen kann.
Wegen einer negativen Flüssigkeitsbilanz, auf Deutsch ausgedrückt, ich trank zu wenig, wurde ich nicht nur von den Ärzten, sondern auch von Mutti und anderen Besuchern zum Trinken aufgefordert. „Sonst gibt es eine Infusion mehr“, wurde mir angedroht. Die Androhung dürfte ich aber nicht sehr ernst genommen haben. Ich war nicht bereit, einen Schluck mehr zu machen und wurde deshalb immer mit dem täglichen „Venensaft“ bestraft.
Muttis Alltag verlagerte sich zunehmend von ihrer Wohnung ins Krankenhaus. Wieviel Zeit sie neben mir verbracht hatte, weiß ich wirklich nicht. Damit es ihr aber etwas leichter fiel, nahm sie manchmal auch eine Freundin mit. Tante Grete und Frau Dostal, die beide im selben Haus wie meine Eltern wohnen, begleiteten Mutti.
So schilderte mir Frau Dostal jetzt den Spitalsbesuch. Sie war einmal auf der Intensivstation meines Dauerschlafes. Anstelle mit mir zu plaudern, konnte sie sich nur mit Mutti und den Zimmerkollegen unterhalten. Viel lebendiger war ich bei ihrem zweiten Besuch. Diesmal lag ich schon auf der Normalstation und war viel gesprächiger. Ich erkannte sie gleich und fing zum Tratschen an. Wie weit sie damals meine eigenartige Rederei verstand, hatte sie mir aber nicht verraten.
Tante Grete war nach dem Aufenthalt auf der Intensivstation ein paar Mal zu Besuch. Bei ihre war ich nicht sehr gesprächig, verwendete viele falsche und unverständliche Wörter und wurde bald müde. Ein paar Tage später, war ich bei Tante Gretes Besuch gut gelaunt und sehr froh, dass unser Spitalsspaziergang im Krankenhaus eine Pause fand, weil ich schon müde war. Auf dem Weg zur Jausenstation war ich so eine Plaudertasche, dass ich jedem Menschen, der uns entgegenkam, gleich grüßte und ein paar Worte zurief. Damit Tante Grate nach dem Besuch wieder den richtigen Weg nach Hause finden würde, hätte ich sie gerne begleitet. Leider war das nicht erlaubt. Warum ich damals noch nicht außer Haus durfte, verstand ich überhaupt nicht.
Noch einen Bekannten baten meine Eltern einmal mitzukommen. Gleich nach dem Unfall wurde einem Pater aus unserem benachbarten Pfarrheim von meinem Schicksal erzählt. Bis zu diesem Tag hatte ich seit dem Anfang meiner Studienzeit kein Interesse an Religion und dazugehörenden Kirche gehabt. Meine Eltern waren aber immer schon sehr religiös. Deshalb dachten sie auch daran, dass mir eine Krankensalbung helfen könnte, wieder gesund zu werden. Also brachten sie den Pater drei oder vier Tage nach dem Unfall mit in das Spital. Ich lag tief schlafend in meinem Bett und hatte sicher nichts mitbekommen. Sonst hätte sich meine Herzfrequenz, die ständig am Monitor aufgezeichnet wurden, genauso erhöht wie jedes Mal, wenn ich ein bisschen aufmerksamer wurde. Trotzdem wurde ich gesalbt und ein Gebet für mich gesprochen. Wie es scheint, mehr den Eltern als mir zuliebe.
Jedoch so sinnlos kann diese Handlung einer Krankensalbung aber doch nicht gewesen sein. Fast zwei Monate später war ich wieder daheim und begann langsam ein selbstständiges Leben zu führen. Am ersten Sonntag war ich dann mit meinen Eltern in die Kirche mitgegangen und siehe da, der Gottesdienst war mir diesmal nicht auf die Nerven gegangen. Ich kann nicht behaupten, dass ich seit diesem Tag eine gläubige Christin geworden war, Religion hatte mich nur wieder zu interessiere begonnen. Viel musste ich über die vorgelesenen Kapitel aus der Bibel nachdenken. Bei der Predigt stieg ich geistig weit vor dem Ende aus und versuchte mir klar zu machen, was diese Aussage eigentlich bedeuten sollte. Für mich ist Religion und Kirche seit der Krankensalbung wieder in den Vordergrund gerückt worden und es beschäftigte wieder meinen Geist über den Sinn von Glaubensinhalten nachzudenken.
Brigitte, meine beste Freundin aus der Volksschulzeit, hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. So wie viele andere hatte auch sie von dem Unfall durch einen Zeitungsartikel erfahren. Da sie beruflich als Krankenschwester im AKH tätig war, fand sie mich leicht in der entsprechenden Intensivstation. Leiter war ich damals überhaupt noch nicht in der Lage, diese Begegnung wahrzunehmen.
Besonders erwähnenswert ist mein liebes Brüderlein Peter. Bis zu dem Tag, an dem ich den Unfall hatte, war er für mich nur ein Familienmitglied, bedeutend älter als ich (fünf Jahre) und eher uninteressant. Nun sah es aber ganz anders aus. Vor allem für Peter war ich nicht nur irgendwer, sondern seine Schwester, die seine Hilfe brauchte.
Gleich am Tag nach dem Unfall riefen meine Eltern in seiner Passauer Wohnung an. Am liebsten wäre er gleich nach Wien gekommen; leider gab es noch wichtige Arbeit in seiner Firma zu erledigen. Zehn Tage später war es aber so weit. Peter konnte endlich nach Wien kommen und machte sich auf den Weg, seine Schwester im AKH zu besuchen. Einfach war es nicht, die passende Station zu finden. Bei der richtigen Eingangstüre musste er dann so wie alle anderen Besucher klopfen. Eine Ärztin machte die Türe auf und fragte, was Peter und sein Freund Gerhard wollten. „Sigrid Kundela wollen wir gerne besuchen“, sagte Peter. Leider war vor kurzer Zeit erst David, ein mir bekannter Medizinstudent, zu Besuch. Also wurden mein Bruder und sein Partner aufgefordert noch eine Weile zu warten. Dann mussten sie, so wie aus hygienischen Gründen vorgeschrieben, den weißen Besucherkittel anziehen, dann erst durften sie zu mir ins Zimmer.
Zwei Stunden saßen Peter und Gerhard bei mir. Leider war ich wieder in einen tiefen Schlaf gefallen. Alle Versuche mich aufzuwecken waren erfolglos. Jede erzählte Geschichte und jeder Schubser waren ergebnislos; meine Augen blieben zu. Es war keine Chance, mich wach zu bekommen, ich schlief fest wie ein Murmeltier.
Am nächsten Tag, sowie auch an den folgenden Besuchertagen von Peter, saß zuerst meine Mutter den ganzen Nachmittag neben mir. Am frühen Abend kam dann Peter und versuchte meine geistige und körperliche Entwicklung zu unterstützen. So war er es zum Beispiel, der es als erster schaffte, mich zu füttern. Bei ihm lernte ich auch wieder, selbst den Löffel mit Essen zu füllen, denselben in den Mund zu schieben, zu kauen und zu schlucken.
Weiters hatte mir Peter erzählt, dass ich damals schwer zu unterhalten war. Ich hatte eine eigene Sprache entwickelt. Gemischt mit Fremdwörtern und seltsamen deutschen Wörtern, erklärte ich für mich entscheidende Dinge in einer Sprache, die nur ich verstehen konnte. Man musste schon ein Fingerspitzengefühl haben, um mitbekommen zu können, was ich gerade sagen wollte. So bezeichnete ich den Ausgang oder eine Telefonzelle als Bühne. Die Votivkirche, die in der Ferne leicht zu erkennen war, nannte ich zwei Figuren. Anstelle von Wörtern, die mir nicht gleich einfielen, verwendete ich die griechischen Silben „alpha“ und „beta“ oder auch „plus“ und „minus“. Ein paar Tage später verwendete ich die Buchstabenkombinationen „ABC“ und „XY“ als Wortersatz. Ganz zu schweigen von der Phase, wo ich ausschließlich englisch sprach. Fast jede Dame, die ich erblickte, wurde von mir gefragt: „Mrs., do you have a husband?“ Auf den erschrockenen Blick der angesprochenen Personen fügte ich gleich hinzu: „I hab kan Hasband!“ Jetzt verstehen sie sicher, was ich meinte!?
Bedauerlicherweise hatte ich damals keine Ahnung, dass mein Bruder Peter hieß. Natürlich hat er seit seinem Geburtstag schon so geheißen. Ich sagte einmal Fritz, dann Gerhard oder Gerald zu ihm. Warum nicht Peter? Ja, damals hatte ich keine Ahnung, dass dieser Name der richtige Name wäre. So oft konnte mir sein richtiger Name gar nicht gesagt werden.
An einen Satz, den ich mehr als nur einmal gesagt hatte, konnte sich Peter gut erinnern. „Mach die Flügel weg“, bat ich ihn immer wieder und wollte damals endlich von den weißen Leinenschnüren, die meine Arme und Beine am Bettrand festhielten, los kommen. So fest dieser Wunsch auch war, wurde er doch aus Sicherheitsgründen nicht erfüllt. Viel zu rasch hätte ich mir sonst die überlebensnotwendigen venösen und arteriellen Zugänge vom Körper gerissen.
Glücklicherweise kam Peter fast immer in Begleitung seines Freundes Gerhard. Zu zweit war es viel leichter mit so einem schwierigen Menschen wie mit mir fertig zu werden. Beide stellten aber bei jedem Besuch fest, dass ich mich schon wieder entscheidend verbessert hätte.
Noch eine lustige Geschichte hatte mir Peter von der Zeit, wo ich schon in der Abteilung für neurologische Rehabilitation gelegen war, erzählt. In einem besonderen Stil war ich damals gesprächig geworden. Peter und seinen Freund bezeichnete ich damals, zu dem Zeitpunkt wo ich wieder müde wurde, als Möbel, die jetzt nach Hause gehen konnten. Klug, wie die beiden waren, hatten sie den Satz gleich verstanden.
Leider bekam nicht nur Peter Spezialhinweise von mir. Zufällig dreht es sich um Dr. Müller, einen Facharzt der Abteilung, der damals hoffentlich auch verstanden hatte, dass ich geistig sehr verwirrt war. So forderte ich den Doktor eindeutig auf: „Wenn Sie gehen, können Sie mich mitnehmen!“ Darauf kam sein Hinweis: „Sie müssen aber noch dableiben.“ Darüber war ich überhaupt nicht begeistert und teilte dem Herrn Doktor mit: „Sie sind aber so schiach!“ – Entschuldigen Sie bitte! Jetzt im Nachhinein finde ich diesen Satz immer noch sehr peinlich und kann nur hoffen, dass der Arzt eben wirklich wusste, was mit mir und meinem Geist los war.
Was damals die Besuche meiner Freundinnen und Freunde betraf, stellte Mutti eine Liste auf. Dieser entsprechend, wurden die Besucher eingeteilt, sodass nicht an einem Tag viele kamen und am nächsten Tag niemand. So geschickt war die Liste, dass zu der Zeit, wo es mir schon besser ging, jeden Tag jemand auf Besuch kam.
Leider konnte ich mir nichts von dem merken, was damals im AKH passierte. Ich hatte deshalb einen Fragebogen entworfen und alle, die mich damals besuchten, gebeten, die Besuche und spezielle Vorfälle zu schildern. Einiges konnte ich auf diesem Weg erfahren und das möchte ich nicht für mich behalten.
Da war zum Beispiel Susi, die Frau von Gerhard, der meinen Bruder Peter fast immer begleitet hatte. Susi kam mich bereits auf der Intensivstation besuchen. Anfangs kam sie nur kurze Zeit, weil ich so müde war und viel schlief. Ihr war mein Kampf gegen die „Flügel“, die Befestigung meiner Arme und Beine, aufgefallen. Susi bezeichnete ich originellerweise als „Lehrerin vom Ländle“ und redete ausschließlich in Englisch mit ihr.
Moni war damals meine beste Freundin, mit der ich mich vor dem Unfall oft getroffen hatte. Über viele Sachen und Probleme plauderten und diskutierten wir damals. Ich hatte fest geschlafen und Moni durch mein gutes Aussehen überrascht. Die Vorstellungen eines Laien wie ein gebrochener, zusammengeflickter Schädel tatsächlich aussieht, gehen eben weit auseinander Das nächste Mal nahm Moni ihren Freund Michael mit. Eigentlich hatte ich diesen Burschen schon sehr gut gekannt. Trotzdem antwortete ich auf die Frage, ob ich ihren Freund kennen würde: „Ja das ist doch Manfred.“ Das war aber leider der Name seines Vorgängers.
Auch daran, dass ich an der nächsten Station, der Abteilung für neurologische Rehabilitation sehr aggressiv wurde, konnte sich Moni nicht erinnern. Einmal kam gerade als sie zu mir ins Zimmer eintreten wollte, meine Mutti weinend herausgelaufen. So böse Sachen musste ich damals zu ihr gesagt haben, dass ich sie extrem traurig gemacht hatte. Keine Erklärung für den Grund meines Aufenthaltes im Krankenhaus wollte ich verstehen. Umbringen wollte ich mich und die „blöden Krankenschwestern“. Jeder Versuch mir beruhigende Worte zuzusprechen war erfolglos und deprimierend.
Damals war ich alles andere als leicht zu überreden Notwendiges einzusehen. Mit viel Mühe und Überredungskraft war es Moni gelungen, mich zu überzeugen, dass ich mit ihr in den Raum ging, wo einige wichtige Untersuchungen gemacht werden mussten. Ja, die Medizinstudenten muss man nicht ständig fördern, dachte ich mir damals. Moni zuliebe ging ich aber trotzdem mit.
Neben Moni gab es als zweite feste Freundin Sissi, die so wie ich viel mit Pferden zu tun hatte. Auch sie erlebte mich bei ihrem ersten Besuch auf der Intensivstation nur schlafend. Als sie dann das zweite Mal vorbei kam, war ich schon etwas wach. Ich redete sehr viel. Als Germanistin sind Sissi natürlich gleich die Sprachschwierigkeiten und Erinnerungslücken aufgefallen und dass ich mich an viele Sachen nicht erinnern konnte. Außerdem verriet sie mir später, dass meine Einstellung gegenüber den Ärzten und Krankenschwestern alles andere als nett war.
Zwei Mädchen, die mich öfter im Spitalsbett liegen sahen, waren meine beiden Cousinen Barbara und Birgit. Beide meinten, dass ich sehr unterschiedlich aufgelegt war. Je länger ich im Krankenhaus war, desto mehr wünschte ich, wieder nach Hause gehen zu dürfen. Es war wirklich schwierig für den Besucher, diesbezüglich verständnisvoll zu reagieren. Natürlich mag kein Mensch freiwillig im Spital liegen, aber gewöhnlich sieht man den Zwang für einen derartigen Aufenthalt ein. Ich verstand das damals nicht. In meinen Augen nützte mein Aufenthalt nur dem Zwecke, Medizinstudenten zu prüfen und zu unterrichten. So beschloss ich nach einigen Wochen die angehenden Ärzte sitzen zu lassen.
Obwohl das Studium uns schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammenführte, hatte ich noch Kontakt mit einer ehemaligen Kollegin, namens Marietta. Auch sie sah mich auf der Intensivstation zum ersten Mal. Ich war unansprechbar und versetzte damit meine Freundin in eine traurige Stimmung. Ich tat ihr leid, doch konnte sie es mir nicht einmal sagen, weil ich geistig so weit entfernt war. Beim nächsten Mal erkannte ich sie bereits als sie bei der Tür herein kam. Ich war sehr gesprächig, erzählte pausenlos etwas von „plus-minus“ und füllte damit leere Stellen in meinem Sprachrepertoire auf. Ich bekam überhaupt nicht mit, dass Marietta eigentlich nichts von meinem ständigen Gerede verstand.
Marietta hatte damals einen neuen Freund, den sie mittlerweile bereits geheiratet hatte. Damals hatte sie aber Bedenken, ob ich dies in meinem Zustand verstehen würde. So bat sie ihren Freund, im Vorzimmer zu warten. Schade, dass der Mann nur die Gänge des AKHs kennenlernen konnte. Ich hätte mich sicher nicht aufgeregt, wenn eine für mich fremde Person gekommen wäre. Wenigstens noch ein Mensch, dem ich alles erzählen hätte können, was mir so spontan einfiel. Gemeinsam hätten sie dann die Inhalte meiner Gespräche überlegen und entschlüsseln können.
Eine weitere Studienkollegin und Freundin ist Margit. Sie wohnt im entfernten Bregenz und es war eigentlich ein Zufall, dass die gerade zu dieser Zeit wieder einmal nach Wien kam. Auf Muttis organisierter Besucherliste erhielt sie gerade noch einen Platz an jenem Tag, wo außer meinen Cousinen noch niemand eingetragen war. Gemeinsam mit Mutti kam Margit in das AKH und mussten mich zuerst einmal suchen, denn in meinem Zimmer war ich nicht. Mutti nahm gleich an, dass ich sicher im Kaffeehaus sitzen würde. Sie hatte natürlich Recht. Margit war etwas schockiert … oder sagen wir lieber überrascht, als sie mich sah. Ich hatte seit unserem letzten Treffen Gewicht abgenommen, wirkte für Margit aus optischer Sicht eingefallen und müde. Noch dazu war ich zu diesem Zeitpunkt schlecht aufgelegt, schimpfte über alle Menschen, die mir einfielen und bezeichnete alle, die damals mein Leben scheinbar schwer machten als „Minus-Typen“.
Außer meinen vielen Freundinnen ging ich aber auch meinen Freunden ab. David und Manfred wurde der Besuch eben sobald erlaubt, weil beide Medizin studierten und laut meiner Mutter dabei sicher etwas lernen würden. So verständlich und natürlich der Anblick für Medizinstudenten sein sollte, waren sie doch ein wenig mitgenommen, als sie mich zum ersten Mal sahen, da es sich doch um eine Freundin handelte. Sie redeten auf mich ein. So schienen sie ihre Angst und Unsicherheit loswerden wollen. Auch diesen Medizinstudenten war es unklar, wieviel oder wie wenig ich eigentlich verstand. Nach rund zehn Minuten ließen sie mich wieder alleine. Sie wussten wohl, dass meine Heilungsphase lange dauern wird. So viel hatten sie bei ihrem Medizinstudium gelernt, dass ein Schädel-Hirn-Trauma durchaus geistige Schäden hinterlassen kann.
Fritz, mein Ex-Freund hatte durch einen Anruf meiner Mutter von dem Vorfall erfahren. Gemeinsam mit David und Manfred wollte er mich noch am selben Tag sehen. Nachdem er sich durch alle möglichen Abteilungen des AKHs durchgefragt hatte, fand er endlich die richtige Intensivstation. Dort angekommen erfuhr er von der Krankenschwester, dass sie pausenlos Besucher wegschicken musste. Erstens wäre der Eintritt in mein Zimmer ohne Genehmigung meiner Eltern verboten und zweitens würde ich in meiner Bewusstlosigkeit sicher kein Auge aufmachen.
Laut seiner Schilderung war er zwei Mal auf der Intensivstation bei mir. Von meiner Mutter und meinem Bruder hatte er schon erfahren, dass ich manchmal munter war, wieder essen konnte und ausschließlich englisch redete. Als Fritz bei mir war, war ich allerdings äußerst ruhig. Nur der Puls erhöhte sich laut Maschinenangabe um fünf bis zehn Schläge in der Minute, wenn er einen Satz sagte. Auch ihm fielen die vielen Apparate, die rund um mein Bett standen und die Fesseln der Arme und Beine auf. Erfreulicherweise war aber mein persönlicher Anblick. So zerquetscht sah mein Gesicht nicht aus, wie man sich vielleicht hätte erwarten können.
Auch an den gemeinsamen Besuch mit David auf der neurologischen Station konnte sich Fritz nach erinnern. Er wusste noch, dass an diesem Tag der nette Dr. Schnider mir einen therapeutischen Ausgang am Wochenende anbot. Ich kümmerte mich aber nur um meine Gäste und ließ den Arzt unbeachtet reden was er wollte. Stattdessen hörte ich meinen Besuchern zu und versuchte den Eindruck zu machen, als würde ich alle erzählten Geschichten verstehen. Nur selbst tat ich mir beim Denken, Reden und Verstehen schwer. Um verschiedene Defizite zu verdecken und um den Redefluss zu erhalten, fügte ich auch jetzt die Wörter „plus“ und „minus“ ein. Langsam begann ich wieder in der humorvollen Art und Weise zu sprechen, wie es für mich typisch war und wieder wurde.
Auch Oliver gehörte zu meinem Freundeskreis. Er war während meines Unfalls gerade auf Urlaub und kam erst Wochen später auf Besuch. Zuvor hatte er schon viel über mich und dem Spital erzählt bekommen. Als er mich zum ersten Mal sah, war er sehr überrascht über meinen doch schon recht guten Zustand. Englisch sprach ich damals nicht mehr. Oliver war überrascht, dass ich überhaupt reden konnte. Ich sprach zwar nur wenige Sätze, aber immerhin. Viel mehr als Oliver hatte mich damals die Infusionsflasche interessiert. Aber nicht weil sie so wie jeden Tag über meinem Bett gehangen war. Nein, ich wollte die Flasche unbedingt loswerden, war aber mit meinen angebundenen Armen viel zu weit entfernt.
Arbeitskolleginnen und Kollegen wurden ebenfalls von Neugier und Mitleidsgefühlen gepackt. Eva, meine beste Freundin in der Redaktion rief so oft wie möglich bei meinen Eltern an und ließ sich schildern, was mit mir los sei. Erst nach ein paar Wochen kam mich Evi mit der Kollegin, die als Ersatz die Redaktion meiner Seiten übernommen hatte, besuchen. Die Ersatz-Kollegin kam mir überhaupt nicht bekannt vor. „Das ist doch Elisabeth, die schon gut ein Jahr bei uns ist“, teilte mir Evi mit. Nein, davon hatte ich wirklich keine Ahnung mehr. Neugierig wie ich war, stellte ich viele Fragen und ließ mir die neuesten Neuigkeiten schildern. Wegen meiner Vergesslichkeit ist mir zumindest alles neu vorgekommen.
Schließlich fällt mir noch ein, dass auch meine Mathematikprofessorin mit ihrer Tochter Tina einmal bei mir vorbei kam. Tina wurde nach der Schule immer von meiner Mutter betreut, deshalb standen wir untereinander noch in Kontakt. Zufällig kamen sie gerade am 4. August, meinem Namenstag mit einem Päckchen zu mir. Als Geschenk bekam ich eine kleine Plüschente, die ich heute noch bei einem genau so großen Bären in meinem Rucksack trage. Woher der Bär kam, weiß ich leider nicht mehr. Ich hatte nur erfahren, dass er schon in der Intensivstation neben mir gesessen war.
Mehr Besuche waren es nicht. Nein, fairerweise muss ich gestehen, dass ich durch die ausgeteilten Fragebögen nicht mehr erfahren hatte.
7. Erster und letzter Ausflug in die Freiheit
Jetzt wollen Sie sicher wissen, wie man diese Überschrift zu verstehen hat. Ganz einfach: Sieben Wochen hatte mich das Spital schon festgehalten. Von einigen Freunden hatte ich ein paarmal gehört, dass Sommerferien wären. Warum sollte ich dann noch länger bei den ärztlich verkleideten Studenten im Spital bleiben? Ich stellte mir selbst diese Frage und kam zu dem Entschluss, dass mich im Krankenhaus niemand mehr für Übungen oder sogar Prüfungen brauchen würde. Also beschloss ich nach Hause zu gehen.
Ich kam auf die Idee, die Krankenschwester nicht mehr länger ärgern zu wollen. Daher war ich sehr froh, dass Papa am Samstag in der Früh mich mit seinem Auto abholen kam. Wie schön und vor allem wie gesund musste die Fahrt ins Freie für mich gewesen sein, endlich wieder frische Luft einatmen zu können.
Wie mein Papa auf die Idee kam mich abzuholen, wollen Sie wissen? Ja, genauer gesagt war es gar nicht die Idee meines Vaters, nein, der nette mich betreuende Arzt Dr. Peter Schnider hatte diesen Einfall. Schon am Mittwoch davor kam er zu mir ins Zimmer und schlug mir vor, das kommende Wochenende tagsüber zu Hause zu verbringen. Nur übernachten müsste ich im Krankenhaus.
Eine „Schnapsidee“! Am Abend wieder ins Spital zurückkommen. Wer mag denn schon tagsüber nach Hause und in der Nacht wieder im Krankenhaus schlafen? Ich hätte gerade dem scheinbar so erfahrenen Medizinstudenten – Dr. Schnider genannt – meine Meinung gesagt, wenn ich Zeit dazu gehabt hätte. Dummerweise hatte ich an dem Mittwoche, gerade in diesem entscheidenden Augenblick Besuch von zwei Freunden. David und Fritz saßen bei mir im Zimmer und plauderten von ihren Urlaubsplänen in den Sommerferien, wo sie überall hinfahren wollten, was sie dort alles sehen und machten würden. So viel erzählten sie mir, dass ich daneben überhaupt keine Zeit mehr für das Angebot von Dr. Schnider hatte. Also wandte sich der Arzt an meine Eltern, die auch im Zimmer bei mir saßen. Der Herr Doktor versuchte ihnen alles bezüglich meines möglichen Ausfluges am Wochenende zu erklären. Meine Eltern stimmten dem vielversprechenden Vorschlag zu. Dann verließ der Arzt mein Zimmer. „Auf Wiedersehen“, hatte er wahrscheinlich noch gesagt. Nur weshalb er eigentlich bei mir war, hatte er nicht noch einmal versucht mir zu erklären. Aber ganz egal, Hauptsache ich konnte am kommenden Wochenende nach Hause gehen. Irgendwann gingen an diesem Mittwochabend meine Eltern und die netten Freunde wieder nach Hause.
Endlich war es dann so weit. Der angekündigte Samstag war gekommen. Papa ließ ein bisschen auf sich warten. Nun gut, nicht jeder Mensch wird tagtäglich pünktlich um halb sieben Uhr in der Früh munter. Mein Vater scheinbar nicht. Aber Hauptsache er hatte mich nicht vergessen.
Freiwillig führte mich Papa dann über den ganzen Wiener Innenring. Alle Gebäude kannte ich noch gut, nur mit dem Namen waren wir uns nicht immer einig. Schließlich war ich froh, als wir endlich bei uns zu Hause das Auto einparkten.
Dann ging es hinauf in den zweite Stock. Dort lagen meine kleine Garconniere und die große Wohnung der Eltern. Da ich schon länger nicht mehr zu Hause und mein Kühlschrank entsprechend leer war, nahm ich im Wohnzimmer meiner Eltern Platz. Endlich konnte ich von Mutti, anstelle von einer Krankenschwester, die ich schon nicht mehr sehen konnte, genüsslich bedient werden.
Was es an diesem Tag zu Mittag gegeben hatte, weiß leider niemand mehr. Aber ganz egal damals hatte ich unverständlicherweise ohnehin alles gerne gegessen. Auch Tomaten und Rosinen hätten damals das Essen nicht so verleidet wie früher oder auch heute wieder.
Am Nachmittag nach meinem Mittagsschlaf stand dann die Jause am Programm. Sogar Margit, meine Bregenzer Freundin, die damals gerade in Wien war, besuchte mich. Länge mal Breite hatte ich ihr dann erzählt, wie schlecht es mir im Spital ging und dass ich ohnehin nie mehr dorthin zurückgehen werde. Dann gab es Kuchen und Kaffee.
Viel hatten wir geplaudert. Die Zeit war schnell vergangen. Dann musste Margit wieder nach Hause. Weil sie so lieb und nett war, brachten wir sie sogar mit Papas Auto nach Hause. Als nächste kam ich dann an die Reihe … nämlich wieder ins Spital geführt zu werden.
Ja leider es blieb mir nicht erspart. Ich musste wieder in den roten Bettenturm des AKH auf die Ebene 14 gebracht werden. Vielleicht hatte der junge Herr Doktor, der den Ausflug angeboten und dieses Wochenende Dienst hatte, schon auf mich gewartet. Ich wollte aber auf keinem Fall zurück in das Krankenhaus. Ich war doch nicht krank! Das dachte ich zumindest und keiner, der versucht hatte mir diesen Rückkehrzwang zu erklären, konnte es mir verständlich machen.
Aber morgen am Sonntag durfte ich wieder nach Hause. Das war die Ausrede, mit der sich meine Eltern dann verabschiedeten und mir eine gute Nacht wünschten. Wie gut die Nacht war, weiß ich nicht mehr. Doch nach all den Aufregungen hatte ich sicher nicht recht gut geschlafen.
Sonntag, halb sieben Uhr. Spätestens jetzt war ich wieder munter. Papa hatte mich löblicherweise nicht vergessen und mich zeitig in der Früh abgeholt. Er brachte mich nach Hause, wo ich kaum beim Tisch sitzend anfing zu erklären, wie schlecht behandelt ich mir vorkam. Abgeschoben und herumgeschubst, so wie es die anderen eben wollten, war ich mir vorgekommen. Aber ich war doch kein kleines Kind mehr. Ganz im Gegenteil. Ich war erwachsen und eigentlich gewohnt, das zu tun, was ich wollte.
Genau das hatte ich immer wieder meinen Eltern erklärt. So gern hätten sie ihre Tochter, hatten sie immer wieder behauptet. Trotzdem wurde vieles, was ich wollte, nicht gemacht und manches, was ich überhaupt nicht wollte, doch gemacht. So schlecht behandelt war ich mir vorgekommen, dass ich meinem ärgerlichen Leben ein Ende bereiten wollte. Das schien mir die einzige Lösung zu sein.
Zu weinen hatte ich begonnen. So war ich damals. Jenes weibliche Wesen, das seit seiner Kindheit nicht mehr geweint hatte. Weder körperliche noch seelische Schmerzen hatten mich jemals dazu gebracht. Und jetzt war ich auf einmal umgekippt.
Mutti und Papa waren mit mir und meinen Sorgen überfordert. Um sich selbst wieder etwas erfrischen zu können, durfte ich zu meiner Tante gehen. Sie wohnt im selben Haus, nur einen Stock tiefer. Auch ihr erzählte ich, wie schlecht behandelt ich mir vorkam. Dann bat ich sie, mir endlich die Wahrheit zu sagen, warum ich eigentlich im Krankenhaus war. Sie war doch eine ältere Lehrerin. Die Tante wird nicht lügen, dachte ich. Aber auch sie fing wieder mit meinem Unfall an. Ich unterbrach sie gleich nach ein paar Sätzen und wollte darüber nichts hören. Noch jemand, der mir nicht die Wahrheit sagte, dachte ich.
Nachdem ich dann bei der Tante am Balkon frische Luft schnappen konnte, ging es mir wieder besser. Auch meine Eltern fühlten sich bald wieder wohler. Dann holten sie mich ab und beschlossen, mit mir einen Ausflug zu meinem Pferd in Pressbaum zu machen.
Eine gute Idee. Endlich konnte mich mein liebes Pferd namens Trocadero wieder sehen. Es wird sich freuen und nach mir wiehern, weil es mich schon so lange vermisst hatte. So redete ich es mir zumindest ein. Troci, so hatte ich Trocadero immer genannt, hatte die Karotten und Äpfel, die ich mitbrachte sehr gern. Nur deshalb hatte er mir jedes Mal entgegengewiehert. Daran hatte ich damals nicht gedacht.
Endlich im Stall angekommen, wartete ich gar nicht bis Papa sein Auto eingeparkt hatte. Ich sprang gleich aus dem Auto und ging zu meinem lieben Troci. Er war doch noch lieb oder? Kaum stand ich vor seiner Box, vermisste ich schon sein Brummeln, so tief hatte er immer gewiehert. Dann machte ich die Tür seiner Box auf und ging hinein. Dabei erzählte ich ihm wie froh ich war, dass ich ihn endlich wieder sehen konnte. Und was machte Troci? Er stand immer noch im selben Eck von seiner Box und sah mit stummschweigend an.
Ich war traurig. Besser gesagt verärgert war ich. Ich klopfte ihm noch einmal auf den Hals, drehte mich um und ging aus seiner Box heraus. So sehr ging ich meinem Pferd gar nicht ab. Also beschloss ich wieder zu gehen, denn wenn ich dem Pferd egal war, dann war auch mir das Pferd egal.
Länger als zwei bis drei Minuten hatte ich für meinen Pferdebesuch nicht gebraucht. Papa war gerade fertig mit dem Einparken und in den Stall gekommen, als ich die Boxentüre zudrückte und meinte, wir können wieder nach Hause fahren. Da sich meine Eltern bei Pferden überhaupt nicht auskannten, mussten sie mir hilflos zustimmen und wir fuhren wieder los.
Nach dem Mittagessen begann ich wieder schlecht gelaunt zu reden. Um mich ein wenig abzulenken, wurden Barbara und Birgit eingeladen. Meine zwei Cousinen hatten mich seit dem Unfall schon ein paar Mal im Spital besucht. Endlich blieb ihnen die Fahrt ins AKH erspart und wir konnten zu Hause Kaffee trinken und plaudern. Sogar gespielt hatten wir. Zuerst kam das witzige Schweinderlwürfeln an die Reihe. Dabei muss man zählen, wieviel die gewürfelten Schweinchenfiguren, je nach ihrer Lage, wert sind. Dann spielten wir noch eine Partie „Mensch, ärgere Dich nicht1“. Vielleicht war dahinter der Gedanke „Sigrid, ärgere Dich nicht!“ versteckt.
Papa fuhr in der Zwischenzeit zu Tante Erni, die Mutti von Barbara und Birgit, in den Garten. Der Grund dafür war die Tatsache, dass ich pausenlos über Papa schimpfte. Ich wusste schon, dass er mich wieder ins Spital bringen wollte. Wenn er aber nicht zu Hause war, dann konnte er mich nicht ins Krankenhaus bringen.
Froh und gut gelaunt war ich. Leider oder glücklicherweise war mein Gehirn noch nicht in der Lage alles zu verstehen. Meine Überraschung war nämlich sehr groß, als ich erfuhr, dass meine Cousine Barbara mit dem Auto da sei. Das Gefährt war aber nicht nur ihr zuliebe mitgebracht worden, um ihr den Anmarsch zu erleichtern. Nein, für mich war es mitgekommen, um mich in das Spital zu bringen.
Sicher hatte ich die ganze Fahrt geschimpft. Sogar auf dem ganzen Weg bis zu meinem Zimmer im 14. Stock verlor ich kein freundliches Wort. Kaum im Zimmer angekommen, schmiss ich die Türe zu. Niemanden wollte ich mehr sehen.
So gingen die zwei Ausflugstage zu Ende. Mehr als nur schlecht gelaunt saß ich dann in meinem Spitalsbett und beschloss auf irgendeine Art und Weise dem Ärger ein Ende zu bereiten.
8. Flucht aus der ungeliebten Heimat
Ich wollte den Ärger verdrängen. Für mich gab es dafür nur eine Lösung: Flucht vor den Ärzten – Flucht aus dem Spital.
So wie immer war ich auch an jenem Montag nach dem erschreckenden Wochenende um halb sieben Uhr in der Früh munter geworden. Gewöhnlich wird um diese Zeit Fieber gemessen, dann wäscht man sich und wartet auf das Frühstück. Meist sprach ich in dieser Zeit mit der Hilfsschwester, die in der Küche arbeitete und erklärte ihr, wie sie das Essen zubereiten sollte.
An diesem Montag war ich gegangen. Ich zog mich an, packte meine Sachen zusammen, verabschiedete mich von den beiden Zimmerkolleginnen und verschwand. Mit zwei Sackerln ging ich zum Lift. Lange ließ er nicht auf sich warten. Ich stieg ein und drückte auf den Fünfer. So gut kannte ich mich in diesem Monsterspital schon aus, dass ich wusste, auf Ebene Fünf ist der Ausgang.
Mit dem Lift dort angekommen, stieg ich aus und ging in Richtung Haupteingang, der gleichzeitig auch der Hauptausgang ist. Diese Strecke kannte ich schon sehr gut. Am Wochenende zu Papas Auto musste wir auch so gegangen sein. Außerdem war ich oft im Cafe Clinicum gewesen und war auf dem Weg dorthin jedes Mal beim Hauptausgang vorbeigekommen.
Ich brauchte schon eine Weile bis ich bei der selengesteuerten Ausgangstüre beim Hauptausgang war. Das Tor ging auf. Dann stand ich am Taxi-Standplatz und setzte mich gleich in den ersten Wagen. Als ich gerade anfing dem Fahrer meine Adresse zu sagen, riss jemand die Autotüre auf. Zwei Krankenschwestern von der Station 14K hatten gerade noch das Taxi, mit dem ich fliehen wollte, erreicht. In ein paar Worten erklärten sie dem Fahrer, dass er mich nicht mitnehmen dürfte. Dann zogen sie mich aus dem Fahrzeug heraus, setzten mich in einen Rollstuhl und schoben mich wieder zurück.
Ebene 14, Abteilung für Neurologische Rehabilitation war Endpunkt meiner Reise. All meine Erklärungen weshalb ich ins Taxi gestiegen war und warum ich es dort oben in meinem Zimmer nicht mehr aushalten konnte, nützten nichts. Sie brachten mich trotz meines Widerstandes zurück. Aber nicht zurück in mein Zimmer, wahrscheinlich hatten sie Angst, dass ich noch einen Fluchtversuch wagen würde. Sicherheitshalber wurde ich in den Schwesternstützpunkt gesetzt.
Etliche Mappen und Ordner standen in den Regalen. Karteizettel wurden beschriftet. Auch einen Computer gab es. Es hätte mich eigentlich an meine Arbeitsstätte erinnern können. Aber daran konnte ich jetzt gar nicht denken. Viel mehr war ich mit dem Schimpfen beschäftigt und jedem, der vorbei kam, erzählte ich wie schlecht es einem in diesem Krankenhaus ginge.
Leider hatte ich keine Ahnung, was die Ärzte im Zimmer nebenan besprachen. Endlich kam ein Arzt aus dem Zimmer und bot mir an, bei mir daheim anzurufen. Meine Eltern könnten mich abholen. Hatte ich richtig gehört? Ich durfte jetzt in der Früh meine Eltern telefonisch aufwecken und ihnen sagen, dass sie mich nach Hause bringen dürften.
Um diesen netten Vorschlag brauchte man mich nicht zweimal bitten. Natürlich saß ich gleich beim Telefon, wählte die Nummer meiner Eltern und teilte ihnen mit, dass es nett wäre, wenn sie mich abholen würden.
War das eine Erleichterung für mich, endlich wieder ein normales Leben daheim führen zu können. Wenn meine Eltern nur nicht so lange gebraucht hätten! Jede Minute kam mir wie eine Stunde vor. Dann kamen sie endlich den Gang entlang. Ich gab ihnen gleich meine zwei Sackerln. Ob ich dann noch „Auf Wiedersehen!“ gerufen hatte, weiß ich nicht. Aber ganz egal, Hauptsache der Lift kam und brachte uns hinunter.
Leider gingen wir nicht gleich zum Auto. Mutti musste mich noch irgendwie ablenken. Papa wollte bei seiner Arbeitsstätte anrufen. Wieder musste ich im AKH-Eingangssaal sitzen und warten. Gerade dort, wo ich doch keine Sekunde länger bleiben wollte.
Nach endloser Zeit, wahrscheinlich nach einer halben Stunde konnte ich bequem in Papas Auto Platz nehmen und wurde endlich nach Hause geführt.
9. Endlich wieder daheim
Lange genug habe ich geschildert, was sich während meines stationären Aufenthaltes im AKH alles ereignete. Eines Tages hatte der Aufenthalt endlich ein Ende gefunden. Leider hatte man mich vor meiner Entlassung noch für diverse Untersuchungen und Therapien eingeteilt. So war mein letzter Tag im Spital nur mein letzter Tag im Spitalsbett. Als Patientin wurde ich immer noch gerne gesehen.
So war zum Beispiel die Ambulanz der Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie an mir weiterhin interessiert. Dort sorgte mein Kopf regelmäßig für interessante Röntgenbilder. Ärzte diskutierten dann über die Schraubenlage und drückten ein wenig auf der Stirn herum. Dann ließ man mich entscheiden, ob die Schrauben nun entfernt werden sollten oder nicht. Darauf antwortete ich regelmäßig mit „Nein, danke“. Wer will schon freiwillig eine zusätzliche Operationsnarbe im Gesicht? Mit der Vereinbarung des nächsten Kontrolltermins in einem halben Jahr, der nicht der letzte Termin sein würde, verabschiedeten sich die Ärzte von mir. Zu guter Letzt bekam ich noch den Hinweis, nachzudenken, ob ich die Schrauben nicht doch lieber entfernt haben würde. Nein, danke!
(Es hatte sich dann aber doch eine Mukozele = Ansammlung von Schleim im Stirnbereich gebildet, die am 14. September 2006 im AKH von Dr. Clemens Klug entfernt werden musste, da durch weiteres Wachstum das rechte Auge aus der Höhle gedrückt worden wäre. Soweit sollte und wollte ich es freilich doch nicht kommen lassen.)
Auch die Augenärzte wollten mich mindestens einmal pro Monat sehen, um zu messen, wie sehr die Sehkraft (und vor allem das Gesichtsfeld) meiner Augen zugenommen hatte. Meist wurden mir Tropfen verschrieben, die meine Augen ölen sollten. Nach zwei Monaten war das Fläschchen leer geworden und wurde nicht mehr erneuert, weil dies überhaupt keinen Erfolg gebracht hatte. Ebenso erfolglos verlief eine Schieltherapie. Auch dieses regelmäßige Augentraining im AKH wurde nach einer Weile wegen mangelnder Fortschritte abgebrochen.
Zu meinen Augenproblemen gehört noch ein zusätzliches. Ein Jahr nach dem Unfall wurde bei einer Kur im Salzburger Land von einem Arzt auch festgestellt, wie schlecht meine Augen sehen konnten. Dreimal bekam ich verschiedene Übungsbrillen zum Testen in das Kurheim. Dann hieß es: „Eine Schielbrille muss her.“ Kaum verschrieben, ließ ich mir die speziellen Augengläser, die wegen des relativ hohen Gewichtes aus Kunststoff sein mussten, anfertigen. Ein paar Tage konnte ich mich mit intelligentem Aussehen im Kurort zur Schau stellen. Dann musste ich wieder zurück nach Wien. Die Augenambulanz im AKH wollte mich gleich wiedersehen. „Was, Sie haben eine Brille?“ gab ein Arzt der dortigen Ambulanz erstaunt von sich. Gleich wurden die Augen begutachtet und getestet. Schließlich wurde mir das Ergebnis mitgeteilt: „Tragen Sie ja keine Brille, sonst werden die Augen noch schlechter und wir müssen sie operieren.“ Da soll sich einer auskennen!?
Also musste ich ohne Brillen bleiben. Leider wird die Sehkraft meiner Augen schlecht bleiben und sich kaum mehr verändern. Die vielen Therapieversuche brachten keinen Erfolg. Wenigstens sind meine Augen seit dem Unfall nicht schlechter geworden. Eine Brille werde ich wohl erst in zehn bis zwanzig Jahren vielleicht aus Altersgründen brauchen.
(Bereits seit 2000 brauche ich nun doch eine Sehbrille, die auch den Schieleffekt durch Prisma für besseres Sehen in der Nähe ausgleicht und dadurch mein Leseproblem um Vieles erleichtert. Übung macht den Meister!)
Eine Abteilung, die mehr Erfolg hatte, dafür aber um einiges länger brauchte, war die Neurologie. Gleich nach ein paar Tagen in der von mir bezeichneten „Freiheit“ wurde ich zum MRT geschickt. MRT heißt Magnet-Resonanz-Tomografie und bedeutet so viel wie etliche Schichtaufnahmen des Gehirns von allen möglichen Seiten zu machen. Dazu wird man in eine Röhre geschoben. Darin muss man gut 45 Minuten ganz ruhig liegen. Vor einiger Zeit, als ich noch zu den ins Spital eingesperrten Patienten gehörte, konnte diese MRT-Untersuchung nicht durchgeführt werden. Ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür, ruhig zu liegen und mich wie ein Mannequin herumschieben zu lassen. Nicht einmal Dr. Schnider, der sich so oft für mich eingesetzt hatte, war in der Lage mir einzureden, wie wichtig diese Untersuchung wäre. Also gab man sich geschlagen und schob mich damals ohne Erfolg zurück in mein Zimmer. Nach der Entlassung konnte diese Untersuchung dann durchgeführt werden. Irgendwie begann ich damals die Notwendigkeit dieser Untersuchung zu begreifen.
Für die Abteilung der Neurologischen Rehabilitation war die Kontrolle von MRT- und CT-Bildern nur ein kleiner Teil. Regelmäßig, nämlich einmal in der Woche, wurde ich von einer „Frau Doktor“, einer Psychologin erwartet. Sie stellte mir viele Fragen und plauderte gerne über Dinge, die mir persönlich wichtig schienen. Ich glaubte, dass sie auf diese Art versucht hatte, die früheren Erinnerungen in mein vergessliches Gedächtnis wieder zurückzurufen. Vor oder nach unserer intensiven Frage-und-Antwort-Phase schickte mich diese gesprächige Therapeutin in ein Computerzimmer. Dort wurde ich vor viele verschiedene Bildschirmgeräte gesetzt und getestet, wieviel mein Gehirn schon leisten konnte. Als sie sich dann gut auskannte, wurde ich (jahrelang!) zum Training vor diverse Computer gesetzt, um meine geistige Leistungsfähigkeit wieder zu steigern.
So erfolgreich ist die Betreuung einer Psychologin und ich war sehr froh, dass mir diese Behandlung gratis zur Verfügung gestellt wurde. Nie hätte ich mir früher gedacht, dass ein „normaler“ Mensch eine Unterstützung auf geistiger Ebene brauchen könnte. Nur Geisteskranke brauchen eine Hilfe dieser Art, so dachte ich davor. Das stimmt aber gar nicht. Jeder Mensch kann einmal in die Lage kommen, in der eine psychologische Unterstützung notwendig wird.
Diese Art der Langzeittherapie wurde unter dem Namen „neuropsychologische Rehabilitation“ zusammengefasst. Im Wesentlichen sollte meine geistige Fähigkeit trainiert, sowie Konzentration und Aufmerksamkeit gehoben werden. Damit sollte sowohl das „Zurechtfingen im Alltagsleben“ als auch mein Wiedereinstieg ins Berufsleben beschleunigt beziehungsweise erleichtert werden.
Nach gut zwei Jahren war die neuropsychologische Rehabilitation noch nicht am Ende angelangt und hatte sicher noch länger gedauern. Ebenso langwierig war meine ergo-therapeutische Behandlung. Ergänzend zur neuropsychologischen Rehabilitation werden im Rahmen der Ergo-Therapie Fertigkeiten des täglichen Lebens geübt. Anfänglich geistige Überforderung und das Problem mit meinen Augen ließen mich und meine Ergo-Therapeutin nicht verzweifeln. Wenn eine Therapie lange dauert, fällt es schwer, jedes Mal einen Fortschritt zu erkennen. In der Summe betrachtet, war aber nicht zu übersehen, dass ich immer besser und schneller wurde. Bald hatte ich sogar den Ehrgeiz, mich so zu steigern, dass ich bei einem Test die Therapeutin schlagen könnte. Bis jetzt war ich aber noch nicht so weit. (Und bevor es womöglich wirklich so weit gekommen wäre, fand die Ergo-Therapie ein Ende.)
Viel Zeit wandten die Therapeutin und Psychologin für mich auf. Aber es gab noch viel mehr Menschen, die sich um mich kümmerten. Allen voran standen meine Eltern auf der Betreuerliste. Eigentlich wollte ich nach dem Spital sofort wieder in meine gemütliche Wohnung ziehen. Viel zu ängstlich und besorgt waren allerdings meine Eltern. Wer weiß, was mir alles hätte passieren können, deshalb durfte …, musste ich im Schlafzimmer meiner Eltern neben meiner Mutter im Doppelbett schlafen. Papa wurde in der Zwischenzeit zum Übernachten in meine Wohnung umgesiedelt.
Eine Woche danach wollte ich selbstständiger werden. Ich wusste schon, dass ich eine eigene Wohnung und ein eigenes Bett hatte. Dort wollte ich wieder hin. Ich war doch schon alt genug, um selbstständig leben zu können. Endlich war es so weit, alleine im eigenen Bett, innerhalb der eigenen vier Wände hatte ich zum ersten Mal nach lange Zeit ausgezeichnet geschlafen. Lange blieb ich im Bett liegen, obwohl ich eigentlich eine Frühaufsteherin geworden war. Niemand störte meine Ruhe, keine Mitpatienten, keine Krankenschwester, die mich zur Tabletteneinnahme, Morgentoilette oder zum Fiebermessen zwang. Beruhigt konnte ich mich zur Seite drehen, keine fremden Stimmen, keine Pflichten und frühmorgendliche Untersuchungen beeinträchtigten mein Wohlbefinden.
Mit dem neuerlichen Einzug in meine eigene Wohnung, muss ich gestehen, war allerdings vorerst nur das Schlafen im eigenen Bett verbunden. Schmutzige Wäsche landete in Muttis Wäschekisten. Sogar das Essen, angefangen beim Frühstück über das Mittag- und Abendessen fand ausschließlich in der Wohnung meiner Eltern statt. Wer so schlecht sieht wie ich, kann sich nicht selbstständig versorgen!? Lange Zeit waren mir viele Sachen streng verboten. Zum Beispiel durfte ich nicht alleine aus dem Haus gehen. So fuhr Mutti jedes Mal mit mir in das AKH zur Therapie oder zu ärztlichen Kontrolluntersuchungen. Angeblich hätte mich sonst beim Überqueren einer Straße sicher ein Auto niedergeführt.
Bald hatte ich mich an meinen Gesichtsfeldausfall gewöhnt. Ich war mir ganz sicher, dass ich genau auf den Verkehr achten konnte, jedoch dauerte es noch lange, bis ich auch dieses Problem in den Griff bekam. Viel zu viel Angst hatte vor allem meine Mutti, dass ich wieder Opfer eines Unfalls werden würde.
Als ich mit meinem Bruder Peter einmal ein paar Tage allein in Wien geblieben war, bot ich ihm an, morgens für das Frühstück ein paar frische Kipferln und Semmeln kaufen zu gehen. Da er alles andere als ein begeisterter Frühaufsteher war, stimmte er meinem Vorschlag zu und bat mich, nicht die Hauptstraße zu überqueren. Natürlich würde ich aufpassen, stimmte ich ihm zu. Am nächsten Morgen war ich zum ersten Mal wieder alleine. Ein glorreiches Gefühl war das: endlich einmal ganz alleine und selbstständig in der Öffentlichkeit.
Um die Weihnachtszeit, sechs Monate nach dem Unfall, wurde ich wieder selbstständige Frühstücksköchin. Genau genommen es war am 2. Jänner 1993, jenem Tag, an dem Peter wieder in seine Heimat nach Passau fuhr. Beim Frühstück war für mich kein Tratschkollege mehr da, also konnte ich durchaus auch in meiner eigenen Wohnung alleine beim Essen sitzen. Die Kaffeemaschine konnte ich schon bedienen. Zum Weckerl kaufen durfte ich alleine auf die Straße gehen, also es musste klappen. Und es funktionierte tatsächlich. In Zukunft fand das Frühstück wieder in meiner Wohnung statt.
Was die anderen Mahlzeiten betraf, saß ich natürlich immer noch gerne bei Mutti und Papa. Schon alleine deshalb, weil mir so das Kochproblem erspart blieb. Erst nachdem ich bereits 15 Kilo zugenommen hatte, weigerte ich mich, die hervorragende Kost meiner Mutter in mich hinein zu schlemmern. Viel lieber blieb ich hungrig vor dem Fernseher sitzen, als noch ein paar Deka mehr auf die Waage zu bringen.
Die Kochprobleme betreffend muss ich gestehen, dass ich tatsächlich eine schlechte Köchin geworden war. Es war wirklich unverständlich warum und wieso man so etwas verlernen konnte. Die Tatsache war, dass ich mich an viele Handgriffe nicht erinnerte, mit einem Blick auf das Rezept nicht gleich feststellen konnte, wie die Lebensmittel zusammengemischt gehörten. In erster Linie verwendete ich nie alle vorgeschriebenen Zutaten. Da gab es einen Salzstreuer im Kasten, der dort schon halb verstaubt war, weil er von mir so gut wie nie benutzt wurde. Schließlich hatte ich entscheidende Handgriffe vergessen. So zum Beispiel Knödel in einen Topf kochenden Wassers zu geben. Stattdessen wurden die gerollten Teigkugeln gleich zum Überbacken in das Backrohr geschoben. Ich weiß, über Geschmack lässt sich streiten, aber über solche Fehler braucht man gar kein Wort verlieren.
Ein anderes Kapital mit genauso strittigen Fragen war die Pediküre. Leider sah ich so schlecht, dass ich diese Art der Pflege nicht mehr alleine machen konnte. So war meine Mutti wieder meine Nagelpflegerin geworden. Oft gab es Meinungsverschiedenheiten über gewünschte Nagellänge und Art der Pediküre. Wie lange dürfen Nägel an den Fingern und Zehen werden? Zum Beispiel Nägel feilen. Das kam bei mir überhaupt nicht in Frage, denn dieses „Ritzen“ hielt ich einfach nicht aus. Nur weil es Mutti selbst gerne machte, musste ich mir das noch lange nicht gefallen lassen. (Heute verwende ich einen Nagelknipser.)
Auch meinen Freunden, die bald wussten, dass mein Krankenstand noch länger als ein paar Wochen dauern würde, fiel rasch auf, wie ich mich außerhalb des Spitals weiterentwickelt hatte. Noch lange Zeit fehlten mir die passenden Wörter. Anstelle „plus“ oder „minus“ einzusetzen, begann ich zunehmend zu überlegen. Wie könnte das richtige Wort heißen? Ich war mir ganz sicher, dass ich es wissen müsste. Leider trat es oft nicht in den Vordergrund meines Gedächtnisses. Alle Freunde und Bekannten motivierten mich, das passende Wort ohne Mithilfe einzusetzen. Mein Wille war auch sehr groß, wieder ganz richtig und verständlich zu sprechen. Aber wer muss normalerweise beim Reden nachdenken? Gewöhnlich kann man doch sprechen, ohne zu überlegen, wie die notwendigen Wörter heißen. Eine Solo-Denk-Therapie wurde leider nie von den Ärzten im AKH angeboten. Nein, ganz alleine musste ich mich darum kümmern und kritisch, wie ich schon immer war, passierte es oft, dass ich sehr traurig wurde und meinem sinnvollen Leben lieber ein Ende bereiten wollte.
Leider braucht das Gehirn nach einem Unfall viel länger Zeit als der Körper, um wieder gesund zu werden. So war es auch bei mir. Meinem Körper war nicht viel anzusehen, aber wie sollte jemand bei meinem Anblick erkennen, ob der Kopf schon wieder ganz in Ordnung sei oder nicht. Ich war in der letzten Zeit viel ehrlicher geworden. Genauso wie die Ärzte fragte ich jeden anderen Gesprächspartner, den ich nicht gleich verstand, was er oder sie eigentlich gemeint hätte. Die Reaktionen auf meine erstaunlichen Fragen waren oft sehr unterschiedlich. Manche begannen das Ganze noch einmal mit einfacheren Wörtern langsam zu erklären. So wie man gewöhnlich einem nicht deutsch sprechenden Ausländer etwas begreiflich machen wollte. Andere redeten im gleichen Stil weiter, wiederholten vielleicht teilweise den Inhalt und stellten nach jedem zweiten oder dritten Satz ihrerseits die Frage: „Hast Du´s verstanden?“
Aber nicht nur die Sprache, auch mein Wissen musste sich neu entwickeln. Die normalen Sachen, wie essen, trinken oder auf das Klo gehen, hatte ich rasch wieder gelernt. Wie sah es aber mit der sogenannten höheren Hirnleistung aus? Nicht nur meine Leistungsfähigkeit war stark gesunken. Hinzu kam, dass viel Wissen verstaubt war. Das heißt, ich war nicht ganz dumm geworden, kannte mich aber bei komplexeren Dingen nicht aus. So zum Beispiel mit der Liebe und dem Sex. Einige Jahre früher musste ich das schon einmal erfahren haben, das glaubte ich zu wissen. Ohne Rücksicht auf dieses intime Thema erzählte ich jedem, dem ich begegnete, was mir über meine Liebesgeschichte eingefallen war und wie ich mir das ganze diesbezügliche Geschehen vorstellte … Heute will ich Ihnen das aber nicht mehr ganz ausführlich schildern. Das ist ein privates Thema, das vielleicht meine beste Freundin von mir erfahren kann.
10. Pferde, meine besten Freunde
Lange genug habe ich geschildert, was sich während meines stationären Aufenthaltes im AKH alles ereignete. Eines Tages hatte der Aufenthalt endlich ein Ende gefunden. Leider hatte man mich vor meiner Entlassung noch für diverse Untersuchungen und Therapien eingeteilt. So war mein letzter Tag im Spital nur mein letzter Tag im Spitalsbett. Als Patientin wurde ich immer noch gerne gesehen.
So war zum Beispiel die Ambulanz der Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie an mir weiterhin interessiert. Dort sorgte mein Kopf regelmäßig für interessante Röntgenbilder. Ärzte diskutierten dann über die Schraubenlage und drückten ein wenig auf der Stirn herum. Dann ließ man mich entscheiden, ob die Schrauben nun entfernt werden sollten oder nicht. Darauf antwortete ich regelmäßig mit „Nein, danke“. Wer will schon freiwillig eine zusätzliche Operationsnarbe im Gesicht? Mit der Vereinbarung des nächsten Kontrolltermins in einem halben Jahr, der nicht der letzte Termin sein würde, verabschiedeten sich die Ärzte von mir. Zu guter Letzt bekam ich noch den Hinweis, nachzudenken, ob ich die Schrauben nicht doch lieber entfernt haben würde. Nein, danke!
(Es hatte sich dann aber doch eine Mukozele = Ansammlung von Schleim im Stirnbereich gebildet, die am 14. September 2006 im AKH von Dr. Clemens Klug entfernt werden musste, da durch weiteres Wachstum das rechte Auge aus der Höhle gedrückt worden wäre. Soweit sollte und wollte ich es freilich doch nicht kommen lassen.)
Auch die Augenärzte wollten mich mindestens einmal pro Monat sehen, um zu messen, wie sehr die Sehkraft (und vor allem das Gesichtsfeld) meiner Augen zugenommen hatte. Meist wurden mir Tropfen verschrieben, die meine Augen ölen sollten. Nach zwei Monaten war das Fläschchen leer geworden und wurde nicht mehr erneuert, weil dies überhaupt keinen Erfolg gebracht hatte. Ebenso erfolglos verlief eine Schieltherapie. Auch dieses regelmäßige Augentraining im AKH wurde nach einer Weile wegen mangelnder Fortschritte abgebrochen.
Zu meinen Augenproblemen gehört noch ein zusätzliches. Ein Jahr nach dem Unfall wurde bei einer Kur im Salzburger Land von einem Arzt auch festgestellt, wie schlecht meine Augen sehen konnten. Dreimal bekam ich verschiedene Übungsbrillen zum Testen in das Kurheim. Dann hieß es: „Eine Schielbrille muss her.“ Kaum verschrieben, ließ ich mir die speziellen Augengläser, die wegen des relativ hohen Gewichtes aus Kunststoff sein mussten, anfertigen. Ein paar Tage konnte ich mich mit intelligentem Aussehen im Kurort zur Schau stellen. Dann musste ich wieder zurück nach Wien. Die Augenambulanz im AKH wollte mich gleich wiedersehen. „Was, Sie haben eine Brille?“ gab ein Arzt der dortigen Ambulanz erstaunt von sich. Gleich wurden die Augen begutachtet und getestet. Schließlich wurde mir das Ergebnis mitgeteilt: „Tragen Sie ja keine Brille, sonst werden die Augen noch schlechter und wir müssen sie operieren.“ Da soll sich einer auskennen!?
Also musste ich ohne Brillen bleiben. Leider wird die Sehkraft meiner Augen schlecht bleiben und sich kaum mehr verändern. Die vielen Therapieversuche brachten keinen Erfolg. Wenigstens sind meine Augen seit dem Unfall nicht schlechter geworden. Eine Brille werde ich wohl erst in zehn bis zwanzig Jahren vielleicht aus Altersgründen brauchen.
(Bereits seit 2000 brauche ich nun doch eine Sehbrille, die auch den Schieleffekt durch Prisma für besseres Sehen in der Nähe ausgleicht und dadurch mein Leseproblem um Vieles erleichtert. Übung macht den Meister!)
Eine Abteilung, die mehr Erfolg hatte, dafür aber um einiges länger brauchte, war die Neurologie. Gleich nach ein paar Tagen in der von mir bezeichneten „Freiheit“ wurde ich zum MRT geschickt. MRT heißt Magnet-Resonanz-Tomografie und bedeutet so viel wie etliche Schichtaufnahmen des Gehirns von allen möglichen Seiten zu machen. Dazu wird man in eine Röhre geschoben. Darin muss man gut 45 Minuten ganz ruhig liegen. Vor einiger Zeit, als ich noch zu den ins Spital eingesperrten Patienten gehörte, konnte diese MRT-Untersuchung nicht durchgeführt werden. Ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür, ruhig zu liegen und mich wie ein Mannequin herumschieben zu lassen. Nicht einmal Dr. Schnider, der sich so oft für mich eingesetzt hatte, war in der Lage mir einzureden, wie wichtig diese Untersuchung wäre. Also gab man sich geschlagen und schob mich damals ohne Erfolg zurück in mein Zimmer. Nach der Entlassung konnte diese Untersuchung dann durchgeführt werden. Irgendwie begann ich damals die Notwendigkeit dieser Untersuchung zu begreifen.
Für die Abteilung der Neurologischen Rehabilitation war die Kontrolle von MRT- und CT-Bildern nur ein kleiner Teil. Regelmäßig, nämlich einmal in der Woche, wurde ich von einer „Frau Doktor“, einer Psychologin erwartet. Sie stellte mir viele Fragen und plauderte gerne über Dinge, die mir persönlich wichtig schienen. Ich glaubte, dass sie auf diese Art versucht hatte, die früheren Erinnerungen in mein vergessliches Gedächtnis wieder zurückzurufen. Vor oder nach unserer intensiven Frage-und-Antwort-Phase schickte mich diese gesprächige Therapeutin in ein Computerzimmer. Dort wurde ich vor viele verschiedene Bildschirmgeräte gesetzt und getestet, wieviel mein Gehirn schon leisten konnte. Als sie sich dann gut auskannte, wurde ich (jahrelang!) zum Training vor diverse Computer gesetzt, um meine geistige Leistungsfähigkeit wieder zu steigern.
So erfolgreich ist die Betreuung einer Psychologin und ich war sehr froh, dass mir diese Behandlung gratis zur Verfügung gestellt wurde. Nie hätte ich mir früher gedacht, dass ein „normaler“ Mensch eine Unterstützung auf geistiger Ebene brauchen könnte. Nur Geisteskranke brauchen eine Hilfe dieser Art, so dachte ich davor. Das stimmt aber gar nicht. Jeder Mensch kann einmal in die Lage kommen, in der eine psychologische Unterstützung notwendig wird.
Diese Art der Langzeittherapie wurde unter dem Namen „neuropsychologische Rehabilitation“ zusammengefasst. Im Wesentlichen sollte meine geistige Fähigkeit trainiert, sowie Konzentration und Aufmerksamkeit gehoben werden. Damit sollte sowohl das „Zurechtfingen im Alltagsleben“ als auch mein Wiedereinstieg ins Berufsleben beschleunigt beziehungsweise erleichtert werden.
Nach gut zwei Jahren war die neuropsychologische Rehabilitation noch nicht am Ende angelangt und hatte sicher noch länger gedauern. Ebenso langwierig war meine ergo-therapeutische Behandlung. Ergänzend zur neuropsychologischen Rehabilitation werden im Rahmen der Ergo-Therapie Fertigkeiten des täglichen Lebens geübt. Anfänglich geistige Überforderung und das Problem mit meinen Augen ließen mich und meine Ergo-Therapeutin nicht verzweifeln. Wenn eine Therapie lange dauert, fällt es schwer, jedes Mal einen Fortschritt zu erkennen. In der Summe betrachtet, war aber nicht zu übersehen, dass ich immer besser und schneller wurde. Bald hatte ich sogar den Ehrgeiz, mich so zu steigern, dass ich bei einem Test die Therapeutin schlagen könnte. Bis jetzt war ich aber noch nicht so weit. (Und bevor es womöglich wirklich so weit gekommen wäre, fand die Ergo-Therapie ein Ende.)
Viel Zeit wandten die Therapeutin und Psychologin für mich auf. Aber es gab noch viel mehr Menschen, die sich um mich kümmerten. Allen voran standen meine Eltern auf der Betreuerliste. Eigentlich wollte ich nach dem Spital sofort wieder in meine gemütliche Wohnung ziehen. Viel zu ängstlich und besorgt waren allerdings meine Eltern. Wer weiß, was mir alles hätte passieren können, deshalb durfte …, musste ich im Schlafzimmer meiner Eltern neben meiner Mutter im Doppelbett schlafen. Papa wurde in der Zwischenzeit zum Übernachten in meine Wohnung umgesiedelt.
Eine Woche danach wollte ich selbstständiger werden. Ich wusste schon, dass ich eine eigene Wohnung und ein eigenes Bett hatte. Dort wollte ich wieder hin. Ich war doch schon alt genug, um selbstständig leben zu können. Endlich war es so weit, alleine im eigenen Bett, innerhalb der eigenen vier Wände hatte ich zum ersten Mal nach lange Zeit ausgezeichnet geschlafen. Lange blieb ich im Bett liegen, obwohl ich eigentlich eine Frühaufsteherin geworden war. Niemand störte meine Ruhe, keine Mitpatienten, keine Krankenschwester, die mich zur Tabletteneinnahme, Morgentoilette oder zum Fiebermessen zwang. Beruhigt konnte ich mich zur Seite drehen, keine fremden Stimmen, keine Pflichten und frühmorgendliche Untersuchungen beeinträchtigten mein Wohlbefinden.
Mit dem neuerlichen Einzug in meine eigene Wohnung, muss ich gestehen, war allerdings vorerst nur das Schlafen im eigenen Bett verbunden. Schmutzige Wäsche landete in Muttis Wäschekisten. Sogar das Essen, angefangen beim Frühstück über das Mittag- und Abendessen fand ausschließlich in der Wohnung meiner Eltern statt. Wer so schlecht sieht wie ich, kann sich nicht selbstständig versorgen!? Lange Zeit waren mir viele Sachen streng verboten. Zum Beispiel durfte ich nicht alleine aus dem Haus gehen. So fuhr Mutti jedes Mal mit mir in das AKH zur Therapie oder zu ärztlichen Kontrolluntersuchungen. Angeblich hätte mich sonst beim Überqueren einer Straße sicher ein Auto niedergeführt.
Bald hatte ich mich an meinen Gesichtsfeldausfall gewöhnt. Ich war mir ganz sicher, dass ich genau auf den Verkehr achten konnte, jedoch dauerte es noch lange, bis ich auch dieses Problem in den Griff bekam. Viel zu viel Angst hatte vor allem meine Mutti, dass ich wieder Opfer eines Unfalls werden würde.
Als ich mit meinem Bruder Peter einmal ein paar Tage allein in Wien geblieben war, bot ich ihm an, morgens für das Frühstück ein paar frische Kipferln und Semmeln kaufen zu gehen. Da er alles andere als ein begeisterter Frühaufsteher war, stimmte er meinem Vorschlag zu und bat mich, nicht die Hauptstraße zu überqueren. Natürlich würde ich aufpassen, stimmte ich ihm zu. Am nächsten Morgen war ich zum ersten Mal wieder alleine. Ein glorreiches Gefühl war das: endlich einmal ganz alleine und selbstständig in der Öffentlichkeit.
Um die Weihnachtszeit, sechs Monate nach dem Unfall, wurde ich wieder selbstständige Frühstücksköchin. Genau genommen es war am 2. Jänner 1993, jenem Tag, an dem Peter wieder in seine Heimat nach Passau fuhr. Beim Frühstück war für mich kein Tratschkollege mehr da, also konnte ich durchaus auch in meiner eigenen Wohnung alleine beim Essen sitzen. Die Kaffeemaschine konnte ich schon bedienen. Zum Weckerl kaufen durfte ich alleine auf die Straße gehen, also es musste klappen. Und es funktionierte tatsächlich. In Zukunft fand das Frühstück wieder in meiner Wohnung statt.
Was die anderen Mahlzeiten betraf, saß ich natürlich immer noch gerne bei Mutti und Papa. Schon alleine deshalb, weil mir so das Kochproblem erspart blieb. Erst nachdem ich bereits 15 Kilo zugenommen hatte, weigerte ich mich, die hervorragende Kost meiner Mutter in mich hinein zu schlemmern. Viel lieber blieb ich hungrig vor dem Fernseher sitzen, als noch ein paar Deka mehr auf die Waage zu bringen.
Die Kochprobleme betreffend muss ich gestehen, dass ich tatsächlich eine schlechte Köchin geworden war. Es war wirklich unverständlich warum und wieso man so etwas verlernen konnte. Die Tatsache war, dass ich mich an viele Handgriffe nicht erinnerte, mit einem Blick auf das Rezept nicht gleich feststellen konnte, wie die Lebensmittel zusammengemischt gehörten. In erster Linie verwendete ich nie alle vorgeschriebenen Zutaten. Da gab es einen Salzstreuer im Kasten, der dort schon halb verstaubt war, weil er von mir so gut wie nie benutzt wurde. Schließlich hatte ich entscheidende Handgriffe vergessen. So zum Beispiel Knödel in einen Topf kochenden Wassers zu geben. Stattdessen wurden die gerollten Teigkugeln gleich zum Überbacken in das Backrohr geschoben. Ich weiß, über Geschmack lässt sich streiten, aber über solche Fehler braucht man gar kein Wort verlieren.
Ein anderes Kapital mit genauso strittigen Fragen war die Pediküre. Leider sah ich so schlecht, dass ich diese Art der Pflege nicht mehr alleine machen konnte. So war meine Mutti wieder meine Nagelpflegerin geworden. Oft gab es Meinungsverschiedenheiten über gewünschte Nagellänge und Art der Pediküre. Wie lange dürfen Nägel an den Fingern und Zehen werden? Zum Beispiel Nägel feilen. Das kam bei mir überhaupt nicht in Frage, denn dieses „Ritzen“ hielt ich einfach nicht aus. Nur weil es Mutti selbst gerne machte, musste ich mir das noch lange nicht gefallen lassen. (Heute verwende ich einen Nagelknipser.)
Auch meinen Freunden, die bald wussten, dass mein Krankenstand noch länger als ein paar Wochen dauern würde, fiel rasch auf, wie ich mich außerhalb des Spitals weiterentwickelt hatte. Noch lange Zeit fehlten mir die passenden Wörter. Anstelle „plus“ oder „minus“ einzusetzen, begann ich zunehmend zu überlegen. Wie könnte das richtige Wort heißen? Ich war mir ganz sicher, dass ich es wissen müsste. Leider trat es oft nicht in den Vordergrund meines Gedächtnisses. Alle Freunde und Bekannten motivierten mich, das passende Wort ohne Mithilfe einzusetzen. Mein Wille war auch sehr groß, wieder ganz richtig und verständlich zu sprechen. Aber wer muss normalerweise beim Reden nachdenken? Gewöhnlich kann man doch sprechen, ohne zu überlegen, wie die notwendigen Wörter heißen. Eine Solo-Denk-Therapie wurde leider nie von den Ärzten im AKH angeboten. Nein, ganz alleine musste ich mich darum kümmern und kritisch, wie ich schon immer war, passierte es oft, dass ich sehr traurig wurde und meinem sinnvollen Leben lieber ein Ende bereiten wollte.
Leider braucht das Gehirn nach einem Unfall viel länger Zeit als der Körper, um wieder gesund zu werden. So war es auch bei mir. Meinem Körper war nicht viel anzusehen, aber wie sollte jemand bei meinem Anblick erkennen, ob der Kopf schon wieder ganz in Ordnung sei oder nicht. Ich war in der letzten Zeit viel ehrlicher geworden. Genauso wie die Ärzte fragte ich jeden anderen Gesprächspartner, den ich nicht gleich verstand, was er oder sie eigentlich gemeint hätte. Die Reaktionen auf meine erstaunlichen Fragen waren oft sehr unterschiedlich. Manche begannen das Ganze noch einmal mit einfacheren Wörtern langsam zu erklären. So wie man gewöhnlich einem nicht deutsch sprechenden Ausländer etwas begreiflich machen wollte. Andere redeten im gleichen Stil weiter, wiederholten vielleicht teilweise den Inhalt und stellten nach jedem zweiten oder dritten Satz ihrerseits die Frage: „Hast Du´s verstanden?“
Aber nicht nur die Sprache, auch mein Wissen musste sich neu entwickeln. Die normalen Sachen, wie essen, trinken oder auf das Klo gehen, hatte ich rasch wieder gelernt. Wie sah es aber mit der sogenannten höheren Hirnleistung aus? Nicht nur meine Leistungsfähigkeit war stark gesunken. Hinzu kam, dass viel Wissen verstaubt war. Das heißt, ich war nicht ganz dumm geworden, kannte mich aber bei komplexeren Dingen nicht aus. So zum Beispiel mit der Liebe und dem Sex. Einige Jahre früher musste ich das schon einmal erfahren haben, das glaubte ich zu wissen. Ohne Rücksicht auf dieses intime Thema erzählte ich jedem, dem ich begegnete, was mir über meine Liebesgeschichte eingefallen war und wie ich mir das ganze diesbezügliche Geschehen vorstellte … Heute will ich Ihnen das aber nicht mehr ganz ausführlich schildern. Das ist ein privates Thema, das vielleicht meine beste Freundin von mir erfahren kann.
11. Die Wahrheit vom Braunauer Onkel
Die Verwandtschaft meiner Mutter wohnt seit vielen Jahren in Braunau am Inn, einer netten Kleinstadt in Oberösterreich, wo wir in meiner Kindheit jedes Jahr in den Sommerferien Tante, Onkel und Cousins besuchten. Auch als ich schon älter war und den Sommerurlaub bereits alleine verbrachte, fuhr ich noch ab und zu nach Braunau. Der Kontakt zur Brauner Verwandtschaft blieb eigentlich immer erhalten.
Meine Mutter und die Braunauer Tante Erika waren Schwestern und da die beiden Frauen gerne plauderten, erfuhr diese Verwandtschaft umgehend von meinem Unfall. Alle hatten Mitleid mit mir und wurden telefonisch über meinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden gehalten.
Ein Monat nach meiner Entlassung aus dem AKH, es war schon September, wollten mich meine Eltern ein wenig von Wien und vor allem von den Therapien im Spital ablenken. Eine Fahrt zu den netten Verwandten nach Braunau fanden sie sehr passend. Auch die Ärzte konnten von der Notwendigkeit dieses Ausfluges überzeugt werden. Also meldete uns Mutti bei ihrer Schwester in Braunau an. Das Haus war groß genug für uns alle, die Betten frisch überzogen und der Kühlschrank vollgefüllt. Also brauchten wir nur mehr zu kommen.
Damals war mir noch nicht klar, dass ich einen Autounfall gehabt hatte und deshalb so lange im Krankenhaus gelegen war. Irgendwie dachte ich, dass man mir etwas verheimlichte, dass man mir den wahren Grund meines Zustandes verschwieg. Ich dachte, in Braunau gibt es meinen ehrlichen Onkel. Er würde mir sicher die Wahrheit sagen und nicht so wie alle anderen irgendeine Geschichte erzählen. Als erster Mensch wird er mir verraten, was damals am 23. Juni wirklich passiert war, so dachte ich mir.
In Braunau angekommen, konnte ich endlich frische Luft schnappen. Wie angenehm, keine klimatisierten Räume wie im AKH.
Zuerst kam einmal die Begrüßung mit der Tante, die mich fest umarmte, mich küsste und fragte, wie es mir denn eigentlich ginge. So eine dumme Frage dachte ich mir. Wie kann man denn jemanden im Urlaub fragen, wie es ihm geht? Aber man ist nicht unhöflich, also antwortete ich damit, dass es mir sehr gut ginge. Dann kamen der Reihen nach die Cousins mit ihren Frauen und Kindern, grüßten und teilten mir mit, wie gut ich schon wieder aussehen würde. Dankend reagierte ich und fragte mich selbst, wie hässlich ich wohl früher ausgesehen haben müsste.
Schließlich kam auch mein Onkel. Er lächelte und küsste mich. War er denn jemals zuvor schon so entgegenkommend gewesen? Und dann, ohne dass ich ihn fragte, fing er an über meinen Unfall zu reden. Was war denn das? Der Onkel, der doch gewöhnlich immer nur über Tatsachen sprach, fing auf einmal selbst an von einem – genauer gesagt, von meinem Autounfall zu reden. Wie denn das wirklich passiert sei und was der Rechtsanwalt schon in die Wege geleitet hätte, wollte er wissen.
Also gibt es denn so etwas? Wenn sogar der Onkel von meinem zerquetschten Auto sprach, dann musste wohl etwas davon stimmen.
Ich weiß nicht, wie lange ich noch gebraucht hatte, um meine Gedanken zu ordnen. Nach ein paar Minuten oder Stunden war ich dann so weit. Ich zweifelte nicht mehr an den vielen Aussagen. Ja es stimmte, ich hatte wirklich einen schweren Autounfall gehabt.
Noch etwas Besonderes war in Braunau passiert. Seit meinem Autounfall stand immer ich im Mittelpunkt. Eines Tages bekam aber meine Mutter heftige Bauchschmerzen. Ohne viel zu überlegen, brachten wir sie in das Braunauer Krankenhaus. Mutti dachte, dass man ihr dort den Magen auspumpen würde und dann könnte sie wieder mit uns nach Hause fahren. Dem war aber nicht so. Die Ärzte entschieden etwas anderes. Die Gründe für die Bauchschmerzen waren so unklar, dass die Ärzte meine Mutter eine Nacht lang beobachten wollten.
Auf einmal hatte sich das Blatt gewendet. Mutti stand im Mittelpunkt. Es wurde gar nicht mehr rund um die Uhr über meinen Fall gesprochen. Wie erleichtert fühlte ich mich damals. Ich war endlich wieder in den Hintergrund gerückt.
12. Eine Zeitschrift der besonderen Art
Beruflich war ich in der Redaktion einer bekannten Österreichischen Wochenzeitung beschäftigt. Als Journalistin war ich von Anfang an für den Bereich Medizin zuständig. Die Zuteilung zu diesem Ressort erfolgte eher zufällig, da bei meinem Einstieg in die Redaktion dieser Bereich gerade frei war und von den Kollegen niemand übernehmen wollte.
Einige Zeit später schob man mir auch die Abteilung des „Helfers“ zu. Jeder Mensch, der ein scheinbar unlösbares Problem hatte, konnte beim „Zeitungshelfer“, also bei mir anrufen. Ich versuchte dann den Menschen zu helfen, Probleme zu beseitigen, gute Ratschläge zu geben und Streitereien mit Firmen zu schlichten. Nach meinem Unfall musste sich nun jemand anderer um diese Helfer-Tätigkeit kümmern.
Am Tag nach meinem Unfall rief mein Vater in der Redaktion an und teilte den Grund weshalb ich nicht in die Arbeit gehen konnte, mit. Als erstes erfuhr es der Chef persönlich. Er war ein Frühaufsteher und immer schon jeden Tag zeitig in der Früh in seinem großen Zeitungshaus unterwegs.
Relativ zeitig kam auch Berti, ein netter Arbeitskollege. Er wollte an diesem Mittwoch eigentlich zu einer Recherche nach Oberösterreich fahren und sich aus der Redaktion nur Unterlagen holen. Gleich als er das Haus betrat, erzählte ihm die Telefonistin, dass sie von meinem Unfall gehört hatte und ich im AKH wäre. Berti rief im Krankenhaus an und bekam keine Auskunft. Trotzdem sagte er die Fahrt nach Oberösterreich ab und vertrat mich auf meinem Helfer-Platz.
Als Berti dann die üblichen Tageszeitungen durchblätterte, entdeckte er den bereits erwähnten Bericht, in dem ich als gestorben gemeldet war. Daraufhin ging er zum Chef und teilte ihm die erschreckende Nachricht mit. Dieser wurde daraufhin ganz blass und forderte Berti auf: „Recherchieren S´das nach!“ Wieder ging er zum Telefon (Handy gab es damals noch nicht!) und probierte noch einmal aus dem AKH eine Information zu bekommen. Viel konnte er nicht erfahren, nur so viel, dass ich noch am Leben sei. Diese Neuigkeit wurde dem Chef sofort mitgeteilt. Dieser wurde daraufhin ganz zornig, weil er als Zeitungschef natürlich überhaupt kein Verständnis dafür hatte, dass so eine erschreckende Nachricht falsch verbreitet wurde.
So böse man über diese falsche Zeitungsnachricht auch war, umso erleichterter war man, als man die Wahrheit erfuhr. Die Wahrheit war aber auch, dass ich wohl eine Weile nicht am „Helfer-Platz“ arbeiten konnte. Also wurde neben Berti meine Kollegin und Freundin Evi gefragt, ob sie es nicht machen könnte. Evi war eine Zeit lang bei mir im Redaktionszimmer gesessen und hatte damals viele Fälle für mich erledigt. Jetzt konnte sie aber nicht mehr einspringen, da sie in einem anderen Ressort unersetzbar war. Schließlich wurde Elisabeth dazu gedrängt meine Arbeit zu übernehmen. Elisabeth war bis zu diesem Zeitpunkt für viele verschiedene Aufgabenbereiche zuständig gewesen. (Dieser „Helfer-Platz“ existiert heute allerdings schon lange nicht mehr!)
Diese drei Kollegen und Freunde wollten mich dann am frühen Nachmittag im AKH Besuchen. Auch Marion, meine Freundin aus der Wirtschaftsabteilung, die oft am „Helfer-Platz“ aushalf, war mit dabei. Im Spital angekommen, die richtige Abteilung gefunden, bekamen sie die übliche Auskunft zu hören: „Nein, Frau Kundela können Sie nicht sehen.“ Berti erfuhr dann von einem Arzt, dass ich noch im Koma liegen würde. Also mussten sie das Krankenhaus mit dem Blumenstrauß, der für mich gedacht war, wieder verlassen. Schade! Jetzt im Nachhinein tun sie mir noch leid, dass sie umsonst in das Spital gekommen waren.
Weitere Entwicklungen über mich und meinen gesundheitlichen Zustand erfuhren die Kollegen dann telefonisch von meinen Eltern. Meistens war meine Mutter am Apparat. Einmal bat meine Mutter dann meinen Vertreter der Helferabteilung, die nette Besitzerin von dem Gasthaus, das nahe am Unfallort war, auf das „Podest“ zu heben. (Unter diesem Titel wurde in jeder Ausgabe eine Person mit positivem Verhalten gelobt.) Verständlicherweise ausgedrückt bedeutet das, in jeder Ausgabe dieser Wochenzeitung, an einer bestimmten Stelle, eine verdiente Person mit ihrer netten Tat in einem kurzen Artikel zu loben. So bin ich dann zum ersten Mal in meinem Leben selbst in einem Beitrag auf meiner nahezu „eigenen Seite“ vorgekommen.

Das war wie gesagt die Idee und Bitte meiner Mutter. Aber auch mein Chef ließ den Kopf nicht hängen. Eine Mitarbeiterin aus der Politik-Abteilung wurde gebeten, einen Beitrag über das Problem der Autoraserei zu schreiben. So war dann eine Auseinandersetzung mit diesem Problem für alle Menschen zu lesen.


Gleich nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte ich Lust, meine Arbeitskollegen und Freunde zu besuchen. Fast ein Monat musste ich warten, dann war es endlich so weit. Mit meiner Mutter und meinem Bruder, der seinen Urlaub wegen mir in Wien verbrachte, fuhren wir in die Redaktion.
Erstaunlicherweise kannte ich mich dort noch sehr gut aus. Ich wusste gleich, dass wir in den ersten Stock fahren mussten und vom Lift aus die zweite Türe links in mein Arbeitszimmer führte. Es stimmte. Auch meinen Arbeitstisch fand ich sofort. Diesmal war er von Berti, der mich vertreten musste, besetzt.
Nachdem die Kollegen erfahren hatten, dass ich auf Besuch war, kamen sie der Reihe nach in mein ehemaliges Redaktionszimmer und stellten mir die übliche Frage: „Na, wie geht´s Dir denn?“ „So gut wie immer“, antwortete ich kurz und bündig. Dann teilte ich jedem mit, dass ich bald wieder in die Arbeit kommen würde. Ich hatte doch weder Fieber noch Kopfweh. Also warum sollte ich länger zu Hause bleiben?
Viel später lernte ich etwas Mitfühlendes an meinem Chef kennen. Er war keine einfache Person. Mit keinem Mitarbeiter pflegte er private Kontakte. Das einzige persönliche Schreiben, dass man in seinem Firmenpostfach vom Chef vorfinden konnte, war die Kündigung. Für mich gab es jetzt natürlich überhaupt keine Geschäftspost mehr. Sogar mein Postfach war aufgelassen worden. Umso überraschter war ich, als ich von einem längeren Kuraufenthalt in Salzburg zurück kam und mein privates Postfach leerte. Eine Karte aus Wien war dabei. Wer konnte mir denn von meiner Heimatstadt eine Karte schreiben?
Der Text verriet Folgendes:
Liebe Sigrid
Nur Geduld! Eines Tages wird alles wieder gut.
Herzliche Grüße KF
Die zwei Buchstaben als Unterschrift ließen mir dann ein Licht aufleuchten. Es war mein Chef. So kurz hatte er schon immer unterzeichnet. Nun forderte er mich auf, geduldig zu sein. Gut, in dieser Zeit hatte ich mich ein bisschen beruhigt. Ich war nicht mehr rund um die Uhr traurig, dass ich immer noch im Krankenstand war. Laut meinem Chef würde aber einmal der Tag kommen, an dem es mir wieder ganz gut gehen würde. Daran wollte ich glauben. Sehnsüchtig wartete ich dann aber noch lange Zeit auf diesen Tag.
Der Unfall war vor gut zwei Jahren (1992) und immer noch war ich im Krankenstand. Die Krankenkasse hatte mit der reduzierten Bezahlung meines Gehaltes aufgehört. Die Firma musste mich kündigen. So war ich dann am Arbeitsamt in der Abteilung für Behinderte gelandet. Mein Fall war so kompliziert, dass man darüber ein zweites Buch schreiben könnte.
(Nach einem halben Jahr beim AMS wurde mein Gehalt nochmals auf die erforderliche Sozialhilfe verringert. Mein Vater konnte mir dann im Umweltministerium einen Behindertenposten übermitteln, der mich allerdings gar nicht glücklich machte. 1998 war ich wegen eines Augenproblems wieder im AKH und wurde ein Jahr später mit meiner Zustimmung in die Arbeitsunfähigkeits-Pension geschickt.
Daneben hatte ich durch die Veröffentlichung dieses Buches eine andere Beschäftigung gefunden. Durch eine Buchpräsentation im ORF „Willkommen Österreich“ wurde ich von der 1996 einzigen Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirn-Trauma bei der Landesnervenklinik in Mauer-Öhling bei Amstetten eingeladen. Dabei lernte ich die großartige Hilfe durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen dieser Krankheit kennen. In der Folge gründete ich dann gemeinsam mit damals noch Assistenzarzt Dr. Nikolaus Steinhoff im Februar 1997 diese Selbsthilfegruppe in Wien. Das war und ist mein neues Arbeitsgebiet mit einer Pension als „Gehalt“! – Dr. Steinhoff ist mittlerweile Primar im RZ Kittsee geworden.)
13. Kur statt Urlaub
Krank sein, heißt meist Fieber, Husten oder womöglich gar noch Schmerzen zu haben. Da ist man froh, wenn man zu Hause im Bett bleiben darf und nicht in die Arbeit gehen muss. Meist bekommt man verschiedene Medikamente verschrieben, die dem Körper helfen, wieder rasch auf die Beine zu kommen.
Mitunter kann es aber auch komplizierter sein, so wie es nach meinem Schädel-Hirn-Trauma der Fall war. Nachdem ich aus dem Spital entlassen worden war, ging es mir eigentlich schon ziemlich gut. So dachte ich zumindest, denn ich hatte weder Fieber noch Husten und spazierte ohne Schmerzen jeden Tag gerne eine Runde. Obwohl ich mir so gesund vorgekommen war, war ich es aber gar nicht. Einer regelmäßigen Arbeit in der Redaktion konnte ich noch nicht nachkommen. Aus diesem Grund bekam ich von der Krankenkasse einen Teil meines Gehaltes ausbezahlt. Somit musste ich mich aber auch an bestimmte Vorschriften halten.
Zum Beispiel durfte ich meine Heimatstadt Wien nicht verlassen. Eine Reise, womöglich gar ins Ausland war gänzlich verboten. Anscheinend wären die Ärzte in einem fremden Land nicht in der Lage gewesen, einen in Österreich erkrankten Patienten zu helfen.
Ein gutes Jahr nach dem Unfall hatte ich aber ohnehin noch keine Lust zu einer Reise in die verbotene Ferne. Aber sogar eine Fahrt in das benachbarte Bundeland war mir nicht erlaubt. Ich fühlte mich wohl, sodass ich diese Vorschriften nicht verstehen konnte. Ständig in Wien zu bleiben, machte mich traurig. Ich wurde immer aggressiver, schimpfte über alle möglichen unmöglichen Vorschriften und erklärte jedem, dem ich begegnete, welche unglaublichen Gesetze es in diesem Land gibt.
Eines Tages änderte sich aber einiges. Zufällig kam ich auf die Idee, dass eine Kur nicht nur eine schöne Reise wäre, sondern auch der Herstellung meiner Gesundheit sehr dienlich sein könnte.
Warum sollte ich nicht auch die Vorzüge einer Kur kennenlernen? Also stellte ich einen Antrag auf einen Rehabilitationsaufenthalt, wie vorgeschrieben bei meiner Krankenkasse. Nach ein paar Wochen bekam ich dann die Zusage für eine vierwöchige Kur im Salzburger Ort Großgmain, die dann sogar um zwei Wochen verlängert wurde. Wie das gesetzlich geregelt war, wusste ich nicht und war mir auch ganz egal. Hauptsache ich durfte Wien endlich einmal verlassen. Das stimmte mich wieder sehr fröhlich.
Im Juli 1993, gut ein Jahr nach dem Unfall war es dann so weit. Ich packte alles Nötige in einen Koffer. Mutti gab mir noch jede Menge Tipps, was ich sonst noch alles brauchen und mitnehmen könnte. Ich ließ sie reden und machte meinen Koffer genau so voll, wie ich es mir von Anfang an vorgestellt hatte. Mit 29 Jahren ist man wirklich alt genug, um seinen Koffer selbst packen zu können oder?
Dann ging es los. An einem Dienstag in der Früh fuhr ich zum Bahnhof. Natürlich nicht alleine, denn wer weiß, ob es eine Schädel-Hirn-Trauma-Patientin schaffen würde, alleine den richtigen Zug zu besteigen. Dazu kam noch das Gewichtsproblem. Wer kann schon einen extrem schweren Koffer tragen? So ein armes, behindertes Mädchen wie ich durfte damit nicht überfordert werden. Also brachte mich Papa in seinem Auto, begleitet von Mutti und meinem schweren Koffer zum Bahnhof. Dort angekommen, verabschiedete ich mich von beiden und setzte mich in ein hübsches Abteil des richtigen Zuges.
Nach gut drei Stunden hielt der Zug in Salzburg. Selbstständig hatte ich es geschafft, den Waggon ortsgerecht zu verlassen.
Großgmain liegt ganz in der Nähe der Salzburger Hauptstadt. Sicher hätte es einen Bus gegeben, der mich in meinen Kurort gebracht hätte. Erfreulicherweise wurde ich aber von meinem Cousin Dieter, der in Salzburg zu Hause ist, abgeholt und mit dem Auto nach Großgmain gebracht.
Klein und schön ist dieser Kurort. Es war deshalb leicht, das moderne Kurheim zu finden.
Natürlich war ich nicht der einzige Kurgast in diesem großen Haus. Insgesamt waren immer um die 130 Menschen dort auf Kur. Weit mehr als die Hälfte waren wegen Schwierigkeiten mit ihren Herzen aufgenommen worden. Die restlichen 20 Zimmer waren für jene Leute reserviert, die Probleme mit ihren Nerven hatten – eines davon auch für mich.
In dem kleineren Haustrakt waren erfreulicherweise ein paar jüngere Kurgäste. Fünf oder sechs von ihnen waren zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt – jung. Meist handelte es sich um Opfer eines Schlaganfalles. Ich konnte das gar nicht verstehen. Wie kann man in so einem jungen Alter einen Schlaganfall erleiden? Alle zusammen taten mir sehr leid, weil sie ihr Leben von einer Minute auf die andere ändern musste. Genauso tat ich ihnen leid, weil ich so unschuldig zu meinen Verletzungen gekommen war. Das war die Basis der festen Beziehungen, die zwischen uns entstanden und so manche Freundschaft blieb nicht nur während der Kurzeit bestehen.
Als erste Aufgabe nach meiner Ankunft stand dann das Mittagessen auf dem Tagesprogramm. Danach musste ich zu einem Herrn Doktor der neurologischen Abteilung gehen und sollte von diesem Arzt alles weitere erfahren. Zuerst wollte der Herr Doktor viele Sachen von mir wissen. Es war ein nettes Gespräch zwischen uns beiden. Hätte er nicht den weißen Kittel – offenbar die Zwangsbekleidung aller Ärzte – angehabt, wäre ich mir gar nicht wie eine kranke Patientin vorgekommen.
Nach einer netten Plauderei bekam ich alle Therapien, die für mich in Frage kamen, vorgeschlagen. Nichts lehnte ich ab. Immerhin sollte die Kur einen grandiosen Erfolg bringen. Ich wollte den ganzen Tag arbeiten.
Mit einer Wanderung startete dann jeden Tag in der Früh mein Programm. Eine Stunde lang war ich mit einer gemütlichen Gruppe unterwegs. Es ging weder steil bergauf, noch abschüssig bergab. Nach gut einer halben Stunde musste jeder Teilnehmer seinen Puls messen. Das war wahrscheinlich für die Herzpatienten wichtig. Ich fiel jedenfalls nicht wegen eines flotten Herzklopfens auf.
Wieder im Kurheim angekommen, raste ich in mein Zimmer, schlüpfte in die Turnhose und lief quer durch das Haus zur Gymnastikstunde – nein, genau genommen war es nur eine halbe Stunde. Bei netter Musik machten wir einfache Bewegungsübungen. Von Dehn- und Streckfiguren waren wir weit entfernt. Sicher waren auch hier die Übungen in erster Linie für die vielen Herzpatienten, die eben im Alter schon fortgeschrittener waren, gedacht. Nichts desto trotz fand ich diese Art der bequemen Gymnastik nicht schlecht. Mein Kreislauf wurde angeregt und die gewöhnlich eiskalten Zehen aufgewärmt.
Als nächste Therapie musste ich meine Augen mit Bewegungsübungen an einem Computer schulen. Wie dieses Programm in der Fachsprache heißt, habe ich vergessen. Aber ganz egal wie die Wissenschaftler dazu sagen, ich lernte dabei die Augen schneller zu bewegen und durch ständiges Scharfstellen mehr wahrzunehmen.
Dreimal in er Woche war ich im Ergometer-Zimmer bestellt. Mit Ergo-Therapie, wie sie mir aus dem Wiener AKH bekannt war, hatte dieses Training aber überhaupt nichts zu tun. Bei der Ergometrie musste man um die Brust ein Gummiband mit zwei – oder sogar drei – Elektroden versehen. Auf das Kommando „Los!“ musste man dann zu treten beginnen und sich etwa zehn Minuten lange anstrengen. Dabei wurden über die Verbindungskabel ständig EKG-Werte, Puls und Blutdruck kontrolliert. Schlechte Ergebnisse dürfte ich dabei aber nicht erzielt haben, zumindest hatte mich niemand darauf aufmerksam gemacht.
Nach dem gesunden Mittagessen fiel ich geschafft und müde in mein Bett. Damit mir am Nachmittag nicht fad werden konnte, stand Ergo-Therapie am Programm. Genau genommen war es natürlich dieselbe Therapie, die ich aus Wien kannte. Aber jeden Tag üben, bringt mehr Erfolg als nur zweimal in der Woche herausgefordert zu werden.
Das war aber noch gar nicht alles. Einmal in der Woche musste ich zum Herrn Doktor gehen. Er hatte eine Menge Ergebnisse von den Therapeuten bekommen. Ich hatte über viele Erfahrungen zu berichten. Gemeinsam versuchten wir dann, Schwächen zu entdecken und diese mit neuen Therapieschritten auszugleichen.
So wurde ich zu einer Logopädin geschickt. Mit ihrer Hilfe lernte ich wieder lesen. Kaum zu glauben, dass man es in meinem Alter vergessen kann und wieder lernen muss. Von Anfang an schien es mir klar, dass die Buchstaben nebeneinander ein Wort ergaben und mehrere Wörter einen Satz bildeten. Bei meinem Sehproblem mit dem eingeschränkten Gesichtsfeld strengte mich das Lesen aber sehr an. So sehr forderte es mich heraus, dass ich in meinem Gehirn keinen Platz mehr für den Inhalt des gelesenen Satzes hatte. Wie gesagt, die Logopädin lehrte mich, wie ich durch Pausen und Gedächtnisübungen den Inhalt besser verstehen und ihn mit leichter merken konnte.
Zusätzlich wurde ein zweiwöchiger psychologischer Kurs mit der Bezeichnung „Wieder gesund werden“ angeboten. Zu fünft saßen wir bei einer besonders geschulten Ärztin und plauderten über alle Probleme, die sich seit dem Beginn unserer Krankheit ergeben hatten.
Schließlich wurde ich drei Mal in das Landeskrankenhaus Salzburg auf die Augenambulanz geschickt. Dort wurden meine Augen untersucht und getestet. Dann bekam ich die sicher beste aller Brillen verschrieben, zumindest bildete ich mir ein, dass es für mich gar keine bessere Brille geben könnte. Wieder in Wien wurde mir, wie schon berichtet, diese Sehhilfe verboten.
Ja, so sah in Großgmain der Alltag aus. Eine Kur ist eben wirklich etwas ganz anderes als ein Urlaub. Nie kann man sich in die Sonne legen und die Seele baumeln lassen. Rund um die Uhr ist man im Einsatz. Wie schön war es dann, wenn das Wochenende vor der Tür stand und Freunde ihren Besuch telefonisch ankündigten.
Kein Wochenende musste ich alleine verbringen. Meine Eltern kamen gleich drei Mal vorbei. Mutti löste meine Probleme Wäschewaschen und Nägelschneiden. Gemeinsam mit Papa machten wir dann Ausflüge in der schönen Umgebung.
Auch mein Bruderherz Peter kam zwei Mal auf Besuch. Abgesehen von den interessanten Rundreisen um Großgmain war sein Erscheinen aus noch einem Grund sehr erfreulich. Ein paar Tage vor meinem endgültig letzten Kurtag meldete Peter in seiner Firma einen Urlaub an. Seine Reise ging dann natürlich über Großgmain nach Wien und da einem Fahrer alleine im Auto langweilige ist, fuhr ich gerne mit.
Zusätzlich zu meiner engagierten Familie wollten mich auch Verwandte direkt aus Salzburg treffen. Eine von ihnen war Sigrid Kundela, deren Namensgleichheit mit mir zu großen Missverständnissen geführt hatte. Die Zeitungsmeldung von meinem Unfall wurde von ihren Freunden auf sie bezogen. Glücklicherweise konnten sie aber bald über die Wahrheit aufgeklärt werden.
Die namensgleiche Verwandte war außer meiner Familie aber nicht die einzige Besucherin. Weiters verbrachten die beiden Studienkolleginnen Karin und Margit einen ganzen Tag bei mir. Unser Studium war schon seit einiger Zeit vorbei, trotzdem blieben wir treue Freundinnen. Am Abend fuhren sie wieder zurück in ihre westliche Heimat, nach Innsbruck (Tirol) und in das noch entferntere Bregenz (Vorarlberg). Lange hatten wir uns nicht mehr getroffen. Großgmain liegt aber fast genau in der Mitte zwischen unseren Heimatstädten und das wirkte sehr verlockend für ein Treffen.
Schließlich kam noch Andrea, meine ehemalige Schulfreundin vorbei. Noch jemand, der ich alles erklären konnte, was mich freute, was mich ärgerte und was mir alles auf die Nerven ging.
Nach sechs Wochen hatte ich die Kur endlich überstanden. So viele Übungen und Therapien empfand ich damals fast schon als Überforderung. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann glaube ich, dass bei dieser Kur doch alles gepasst hatte und ich viel gesünder zurück nach Wien kam.
14. Der erste Geburtstag mit 29 Jahren
Am 16. Mai 1993 war es wieder so weit. Mein Geburtstag stand am Programm. Wieder war ich ein Jahr älter geworden und sollte diesmal 29 Jahre alt werden. Ein komisches Alter fand ich. Wie kann man 29 Jahre originell feiern? Diesbezüglich fiel mir überhaupt nichts Passendes ein, also beschloss ich, meinen Geburtstag Mitte Mai eher zu ignorieren und nur die üblichen Glückwünsche entgegenzunehmen.
Aber wie gesagt, nur den 29. Geburtstag am 16. Mai wollte ich in diesem Jahr nicht feiern. So mancher Mensch fängt sein Leben noch einmal von vorne an. Auch mir war ein neuer Start vergönnt. Am 23. Juni des Vorjahres, also 1992 fing mein „neues“ Leben an. Sogar in etlichen Zeitungen war darüber berichtet worden. Also war es doch naheliegend, an diesem Tag meinen ersten Geburtstag zu feiern.
Wie kann man so eine außergewöhnliche Feier aber in die Wege leiten? Am besten, man sendet allen Freunden, Verwandten und Bekannten rechtzeitig eine Einladung. Dann wird man sicher bald erfahren, wer kommen mag und kann.
So hatte auch ich begonnen. Schon am 16. Mai, also zu meinem üblichen Geburtstag, schickte ich an alle meine Freunde folgende Einladung:
Wien, 16. Mai 1993
Liebe/Lieber …!
Womöglich wunderst Du Dich, dass ich heuer gar keine Feier für meinen ??. Geburtstag organisiert habe. Nein, das stimmt nicht ganz. Natürlich mache ich auch dieses Mal eine Party zur Feier, allerdings nicht zu meinem Pensionistengeburtstag, sondern zu meinem tollen ersten Geburtstag.
Sicher hast Du Dir schon überlegt, was Du am 23. Juni machen könntest und bis jetzt hast Du noch keine gute Idee gehabt. Also wenn das wirklich der Fall ist bei Dir, dann kann ich Dir helfen. Du kommst am besten zu meiner „Super-Birthday-Party“. Eine Bedingung gibt es aber. Entweder singst Du ein Liedchen (mit Begleitung) oder spielst einen Sketch (alleine oder zu zweit) und/oder Du bringst etwas zum Essen oder Trinken mit – vorher bei mir melden, damit nicht manches fehlt oder doppelt und dreifach kommt.
Damit Du es Dir auch wirklich gut merken kannst, werde ich Dir jetzt alle wichtigen Punkte nochmals zusammenfassen:
Datum: 23. Juni 1993
Zeit: ab 19.00 Uhr
Ort: 1170 Wien; Alszeile 7
Grund: Feier von Sigrids erstem Geburtstag
Nicht vergessen: Lied/Sketch/Essen/Trinken
Ein paar Bekannte werden sich schon melden, dachte ich und die Verwandten werden mich schon aus familiären Unterstützungsgründen nicht sitzen lassen. Und die paar Ärzte und mit meiner „neuen“ Geburt verbundenen Menschen werden sich sicher über so eine witzige Einladung amüsieren und den Zettel lachend in den Mistkübel schmeißen.
Rund 70 Personen, eine kleine Anzahl, hatten die Einladung erhalten. Weit mehr als die Hälfte, sogar über 60 von den eingeladenen Freunden kündigten ihr Erscheinen an. Abgesagt hatte nur eine mickrige Handvoll, die wegen Prüfungsstress oder beruflicher Dienstreise nicht kommen konnten.
Interessant war die telefonische Meldung, in welcher Art man die vorgeschriebene Bedingung erfüllen wollte. Salate wurden angekündigt, dazu gemischtes Gemüse mit Nudeln, Wurst oder Fisch versehen. Weites wurden noch Wurst- und Käseplatten sowie selbstgemachte Brötchen der verschiedensten Arten angeboten. Sogar ein fremdländischer japanischer Fleischkuchen konnte die interessierten Party-Esser erfreuen.
Wer mich kannte, wusste aber, dass mir süße Sachen am liebsten sind. Also konnten auch Kuchen nicht von der Speiseliste gestrichen werden. Und da nicht nur Torten, sondern auch Obstsalate süß sind, wurde damit das Angebot vergrößert. Auch Fruchtsäfte sowie Bier und Wein wollten einige von zu Hause mitnehmen. Also verhungern und verdursten sollte wirklich keiner.
Aber was war mit den Liedern und Sketches los? Konnte denn niemand singen oder spielen? Sogar ein Opernsänger, der mit dem japanischen Fleischkuchen, hatte sein Kommen ohne Gesang angekündigt. Es war wirklich kaum zu glauben, auf der Angebotsliste stand nur ein einziger, der mit seinen beiden Freunden als Schauspieler und Sänger auftreten wollte, nämlich Fritz. Mit David, seinem früheren Schulfreund und Manfred, auch einem Pferdesportkollegen, kündigte er ein Liedchen an. Sie waren mutig, dachte ich mir noch vor dem Auftritt, wenigstens drei Burschen, die uns nicht in der Stille sitzen ließen und erheitern wollten.
Gut ein Monat nach dem Einladungsschreiben war es dann soweit. Am Mittwoch, dem 23. Juni 1993, knapp vor sieben Uhr am Abend begann dann das Fest. Schön langsam ging ich in Richtung Pfarrsaal, dem Ort der Feier. Etwas durcheinander war ich schon. Einerseits dachte ich mir, dass ich vielleicht Gläser und Teller auf die Tische stellen könnte. Andererseits wollte ich aber gar nicht als Erste kommen. Immerhin war ich doch die Hauptperson. Die Besuchermasse könnte später begeistert applaudieren. Nein, nein! Bitte alles, nur das nicht! Das wäre erst recht peinlich.
Wie es das Schicksal wollte, waren doch schon einige Freunde da und alles, wirklich alles war vorbereitet. Zunächst entdeckte ich ein Plakat bei der Buffetwand. Zwei witzige Tiere, ein Hase und ein Vogel, schickten mir bei Sonnenschein mit Blumen einen herzlichen Glückwunsch. Dieses Bild hatte natürlich Gerhard, der Familienfreund und beruflicher Werbegrafiker gemalt.
Als nächstes fiel mir der gedeckte Tisch auf. Weitaus mehr als nur ein paar Brötchen und Salate wurden angeboten. Bald begann ich zu bezweifeln, dass ich von diesen vielen Angeboten überhaupt alles kosten könnte.
Gleich daneben stand der Tisch mit Gläsern und Getränken. Peter, mein liebes Brüderlein, hatte sich dort schon niedergelassen. Als Biertrinker kannte er sich mit dem Fassanzapfen gut aus und wollte den ganzen Abend lang alle Gäste mit den Getränken bedienen.
Noch bevor ich mit dem Kosten anfing, wusste ich gleich, was am besten gelungen war. Vielleicht würde es nicht am besten schmecken, aber es zog alle Blicke auf sich: „Martin“ – mein Rettungshubschrauber – aus Marzipan, in Rosa und Blau, mit Schokoladestützen und Papierpropeller. Mutti hatte es geschafft, eine Freundin, der sie nur ein Foto zeigen konnte, mit dessen Herstellung zu beauftragen. Ein nahezu echter Rettungshubschrauber in süß wurde dann geliefert.
Die meisten Geschenke legten meine Freunde auf einen Tisch, gleich neben der Eingangstür. So konnte ich gar nicht wissen, von wem ich welches Päckchen bekommen hatte.
Langsam füllte sich der Saal. Tante Grete und Onkel Walter stellten sich mit ihren beiden Söhnen ein. Einer der beiden war mit seinem Medizinstudium knapp vor dem Abschluss, der andere war bereits Turnusarzt. Weiters kamen noch drei Frauen aus unserem Wohnhaus. Auch die restliche Verwandtschaft, die einen Häuserblock weiter wohnte, erschienen zeitgerecht.
Was die medizinischen Besucher betraf, musste ich wirklich sagen: Hut ab! Echte Ärzte und unterstützende Helfer, die sich darum gekümmert hatten, dass der Unfall nicht mein letztes Ereignis war – ihnen verdankte ich mein „neues“ Leben.
Auch jene drei Retter aus der Hubschrauber-Crew ließen nicht vergeblich auf sich warten. Etwas später, der angekündigte Partyort war nicht ganz leicht zu finden, ging die Türe auf. Ich traute meinen Augen nicht, als ich die Ärztin, den Sanitäter und den Piloten sah. „Danke, danke“, sagte ich zu der Mannschaft von „Martin“, als sie mir ein Billet und ein eingewickeltes Geschenk gaben. Ich hatte keine Ahnung was in diesem Schachterl sein konnte und fing gleich an, es auszupacken. Ein Sweat-Shirt in dunkelblauer Farbe kam zum Vorschein. Darauf war ein Hubschrauber und die Mitteilung „WIR FLIEGEN FÜR IHR LEBEN“ aufgedruckt. Noch einmal bedankte ich mich dafür, der Spruch stimmte wirklich.
Wie vorhin schon angedeutet, waren mehr als 60 Leute erschienen. Die beiden Schulfreundinnen, mit denen ich seit dem Zeitungsbericht wieder Kontakt hatte und meine Mathematikprofessorin mit ihrer Tochter, auf die meine Mutter öfters aufpasste, kamen auch. Dazu gesellten sich einige Kinder, nein, es waren schon erwachsene Jugendliche meiner ehemaligen Voltigiergruppe, sowie Burschen, die diesen Sport noch aktiv betrieben oder als Trainer tätig waren. Obwohl ich meine Trainertätigkeit damals schon fast aufgegeben hatte, kannte ich noch Freundinnen aus der Pferdesportära, die bei dieser Feier auch nicht fehlen durften.
Auch aus dem Schauspielbereich kamen für mich bekannte Gesichter, dazu noch der ehemalige Arbeitskollege Berti, der mich trotz des langen Krankenstandes nicht vergessen hatte und eine medizinische Nachrichtenvermittlerin.
Bevor ich es vergesse zu erwähnen: eine neue Freundin, die mich mit meinem zerdrückten Kopf im Auto kennengelernt hatte, nahm die weite Anreise von Orth an der Donau in Kauf. Gemeinsam mit ihrem Mann und einem Päckchen durfte ich sie begrüßen. Alles andere als eine Kleinigkeit war in dieser Schachtel von der Unfallzeugin Karin zu finden: eine Augarten-Lampe, von ihr selbst bemalt.
Jetzt habe ich aber niemanden vergessen. Oder? Ach ja, den Hund von der Reitfreundin Irene hatte ich noch nicht erwähnt. Er war eben so brav und still gewesen, dass er überhaupt nicht aufgefallen war.
Um halb acht Uhr, vielleicht war es sogar noch ein bisschen später geworden, eröffnete dann mein Vater offiziell die Feier. Er bedankte sich in meinem Namen für alle mitgebrachten Speisen und Geschenke. Dann erzählte er in zwei, drei Sätzen worum es sich bei diesem Fest handelte. Als nächstes wurde mir ein Baby-Album geschenkt, in dem alle Fotos vom Unfall an, über das Spital, die Hubschrauber-Crew … eingeklebt waren. Bevor das Buffe offiziell eröffnet wurde, las Mutti ein nettes selbstgeschriebenes Gedicht vor:
Zum 1. Geburtstag
Hei, Freunde all von weit und breit,
die ihr zum Fest gekommen seid,
zu Sigrids Ehren – wie ihr wisst,
als Jahrestag bereitet ist.
Ich grüße Euch – im Babystil
Zwölf Monde Leben ist nicht viel,
doch wer einmal dem Tod entrann,
der fängt da neu zu zählen an.
Das, liebe Freunde, macht sie auch,
entsprechend einem alten Brauch.
Die Zeit war kurz, gleich wohl sehr lang,
bis – Gott sei Dank – es ihr gelang.
Wir war´n ein Team und Hand in Hand
hat sie ihr Missgeschick besiegt.
Ihr ahnt gar nicht wie schwer das wiegt.
Sprecht nicht davon – es war bloß Pflicht,
ich sage Euch, aus meiner Sicht
was Euer Handeln menschlich groß
und jeder einzelne famos.
Vom Helikoptereinsatz an,
mit dem der Rettungsakt begann,
bis hin zur Crew im AKH,
Ihr wart für sie wohl ständig da
und jeder half – und hilft noch viel,
nur so kam sie durch Euch ans Ziel.
Ich dank für sie Euch allen hier
und, bitte Leute, glaubt es mir,
ich habe lang nachgedacht,
ob Namensnennung angebracht.
Doch schließlich kam ich zu dem Schluss,
dass man nicht jeden nennen muss.
Ich meine, ihr versteht mich recht,
allein die Reihung liefe schlecht.
Nimm ich das A, das Z erst dran,
fang ich bei Freunden, Ärzten an,
bei Therapeuten, Schwesternschaft,
bei den Piloten oder gar
dem lieben Bruder Peter? – Nein,
ein jeder soll hier erster sein!
Doch nun genug der ernsten Art,
ab jetzt sei Frohsinn nicht erspart.
Teilt ihr das Glück mit ihr und seht,
dass es nun lustig weitergeht.
Hilde Kundela
Damit wurde von meiner Mutter kurz und heiter ausgedrückt, wie dankbar wir allen meinen Helfern waren. Dann wurde das Buffet eröffnet. Anschließend hätte ich netterweise von einem Tisch zum nächsten gehen und mit allen Gästen ein paar Worte plappern sollen. Dazu fehlten mir aber die Kraft und vor allem der Wille. Viel zu sehr lockte mich die „Martin-Crew“. Endlich konnte ich die drei Retter mit Fragen überhäufen. Viel mehr wollte ich noch erfahren, als damals bei einem früheren Besuch am Hubschrauber-Hangar.
Seltsam war der Hinweis, dass ich auf einer Vakuummatratze transportiert worden war. Es bestand nämlich die Gefahr, dass meine Wirbelsäule gebrochen wäre und ich bereits gelähmt sein könnte oder bei starkem Schütteln werden könnte. Deshalb war auch der Hubschrauber gerufen worden, da ein Helikopter viel ruhiger unterwegs ist als ein Rettungsauto.
Ich erfuhr auch, dass der Sanitäter bei dem Einsatz seine Arbeit hatte. Er schleppte alle notwendigen Sachen hin und her. Als nächstes legte er mich in den Hubschrauber. Kaum in die Luft gestiegen, setzte er einen Kopfhörer auf und teilte durch ein Mikrophon dem Krankenhaus alle wichtigen Daten mit.
„Leider bin ich nicht stark genug. Medizin will ich auch nicht mehr studieren, also kommt nur mehr der Pilotenplatz für mich in Frage.“ Zumindest dachte ich mir das damals. Um Pilot zu werden, braucht man aber den Flugschein, muss schon 800 Hubschrauber-Flug-Stunden absolviert haben und muss vor allem gut sehen können. Der Pilot, der auch Rettungspilotenlehrer ist, wusste wie schlecht meine Augen geworden waren. Also war es leider für mich nicht mehr möglich, diesen Beruf zu erlernen.
Viel mehr Sachen um die Rettung und den Flug wurden mir noch erzählt. Irgendwann unterbrach mein Vater alle plaudernden Gäste und kündigte die einzige schauspielerische Vorstellung an. Dann wurde die Saalbeleuchtung abgedunkelt, die Tür ging auf. Fritz erschien mit seiner Gitarre und David, die Noten haltend. Zuletzt trat Manfred in den Raum, grau gekleidet, mit anliegenden Leggins und einem roten Lämpchen-Kranz am Kopf. Alleine dieser Anblick löste die ersten Lacher aus. Dann fing Fritz auf seiner Gitarre zu spielen an. Ein Lied, das dazu mehr als nur gut passte: „Fred vom Jupiter“ lautete der Titel des witzigen Songs.
Den folgenden Applaus hatten sich die Darsteller wirklich verdient. Die Vorstellung war damit aber noch nicht zu Ende. Als nächstes spielte Fritz einen Polizisten am Telefon, der sich bei allen verzweifelten Anrufen nur mit „hilfreichen“ Ausreden drückte. Auch dabei wurde viel gelacht. Nach einem Abschlusslied wurde fest geklatscht. Leider war es schon die letzte Vorführung gewesen, aber wer hätte die Kunst der drei Männer noch überbieten können?
Danach wurde weitergeplaudert. Viel schneller als sonst verging die Zeit und die Freunde begannen sich zu verabschieden. Wer nicht auf Urlaub oder im Krankenstand war, musste eben am nächsten Tag in der Früh wieder zeitig aufstehen.
Knapp vor Mitternacht hatte auch mich die Müdigkeit überfallen. Es war auch fast niemand mehr da. Also verabschiedete ich mich vom Rest, packte die Geschenke so gut wie möglich zusammen, erhielt noch Hilfsträger und ging mit ihnen gemeinsam nach Hause. Endlich daheim schaffte ich es gerade noch mein Nachthemd anzuziehen. Dann fiel ich ins Bett und schlief gleich ein. Ja, die Feier von meinem „ersten“ Geburtstag war zu Ende.
15. Das neue Arbeitsangebot
Seit meinem Unfall sah die Zukunft meines Lebens ganz anders aus. Ich wurde von meiner Firma gekündigt und war sehr deprimiert. (Bis ich dann die SHG-SHT Wien gemeinsam mit Dr. Nikolaus Steinhoff gründete und dadurch endlich wieder einen Sinn an meinem Leben gefunden habe.)
Im AKH am Übungscomputer sitzend, fing ich an über meine Frustration zu sprechen. Interessiert hörte mir die Therapeutin zu und gab mir gleich den Tipp, die Firma, die mich gekündigt hatte, zu vergessen. Das Leben würde doch weitergehen. Ob ich meine Arbeit in dieser oder einer anderen Firma mache, wäre doch ganz egal.
Ich bemühte mich, nicht in Tränen auszubrechen. Das war mir, seitdem mich mein letzter Freund verlassen hatte, nie wieder passiert. Recht feucht waren meine Augen geworden.
Am Heimweg nach der Therapie verzichtete ich auf die Straßenbahn. Viel zu peinlich wäre es mir vorgekommen, vor allen Mitfahrern zu Weinen anzufangen. Zu Fuß stapfte ich mit tränenden Augen nach Hause.
Kaum daheim angekommen, stand meine Mutter bei der Wohnungstür. Warum ich denn jetzt schon nach Hause käme, wollte sie wissen. Was sollte ich da sagen? Es ging nicht mehr anders, aus meinen Augen begannen die Tränen herauszutropfen. Ich begann zu weinen und nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel.
Mutti zog mich daraufhin in die Wohnung meiner Eltern und ließ sich allen Kummer, der mich quälte, erzählen. Nach einiger Zeit war mir alles ganz egal geworden. Für mich bot das Leben wahrlich keinen Sinn mehr an. Wozu sollte es noch länger bestehen bleiben? Immer wieder fragte ich mich, welchen Sinn mein Leben wohl noch hätte. Welche Arbeit mir im Arbeitsmarkt angeboten werden kann, war wirklich fraglich. Jeder Chef, bei dem ich mich bewarb, musste meine Invalidität berücksichtigen. Wer würde mich anstellen, wenn er wüsste, dass ich schlecht sah und wegen meiner Behinderung nicht mehr gekündigt werden dürfte?
Ich müsste leider noch eine Weile warten, bis mir eine passende Arbeit angeboten werden könnte. Oder? Nein, genau genommen stimmte das nicht. Die Arbeit an diesem Buch machte mir viel Freude und Schriftstellerin wollte ich schon immer werden.
Zu guter Letzt
Nun habe ich meine Geschichte erzählt. Mehr als zwei Jahre waren seit meinem Unfall vergangen. Obwohl ich mich körperlich schon wieder ganz gut fühlte, werde ich mich für den Rest meines Lebens mit einer Behinderung abfinden müssen.
In der letzten Zeit machte ich mir viele Gedanken über den Sinn meines Lebens. Genauer betrachtet, fragte ich mich oft, was noch alles passieren müsste, damit das Leben wieder so einen Sinn wie früher für mich hätte. Aber hatte es damals überhaupt einen Sinn gehabt? So gestresst war ich gewesen, dass ich früher nie nachgedacht hatte, ob und wie ich mein Leben sinnvoller gestalten könnte.
Mit Depressionen zu leben, hat zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Ich hatte gelernt, meinen Ärger in der vielen freien Zeit, die ich hatte, wegzuschieben.
Viele neue Freunde hatte ich in den letzten zwei Jahren gefunden. Auch Freunde, die genauso betroffenen waren wie ich. Da waren zum Beispiel Gabi und Anneliese, die trotz ihrer jungen Jahre schon einen schweren Schlaganfall hatte und seither Sprech- und Bewegungsprobleme haben. Auch meine langjährige Schulfreundin Isabella, die durch eine schwere Krankheit fast taub geworden ist, gehört dazu.
Jeder von uns ist froh, nicht die Behinderung des anderen zu haben. Ich bin glücklich, dass meine Augen und nicht meine Ohren schlecht geworden sind. So etwas Ähnliches denkt sich auch Isabella. Allerdings ist sie glücklich, dass nur ihre Ohren und nicht ihre Augen in Mitleidenschaft gezogen worden sind.
Können Sie das verstehen? Was uns selbst betrifft, scheint immer harmlos zu sein. Alle gemeinsam aber haben wir gelernt mit unseren Behinderungen umzugehen. Wir wissen einer vom anderen, was mit uns los ist und können gut miteinander über unsere Probleme reden.
Jetzt, wo ich das Buch zu Ende gebracht hatte, erkannte ich deutlich, wie sehr sich mein Leben von einer Sekunde zur anderen verändert hatte, aber doch nicht ganz sinnlos geworden ist.
Und dieses Buch verhalf mir auch, den Sinn meines Lebens zu finden. Ich hatte damit gelernt meinen Ärger und die daraus entstandene Depression zu bewältigen. Durch die Öffentlichkeitsarbeit in den Medien gelang es mir viel neue Erfahrung zu sammeln und daraus entstand im Februar 1997 in Wien die Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirn-Trauma. Sie ist für mich der neue Sinn meines Lebens geworden. Durch sie hatte ich mir ein neues Arbeitsgebiet geschaffen, für die ich mich gerne täglich einsetze. Obwohl ich fast alle Freunde, die es vor meinem Unfall gab, verloren hatte, gibt es jetzt noch viel mehr neue Freunde, die sich bei vielen gemeinsamen Treffen mehr als nur Erfahrung austauschen können. Alle zusammen sind wir eine große Gemeinschaft geworden und helfen uns gegenseitig den Sinn unseres Lebens zu bewahren.
Nachwort
Von Dr. Peter Schnider, damals Assistenzarzt bei der Ausbildung zum Neurologen im AKH Wien, heute ärztlichen Betreuer der klinischen Abteilung für Neurologische Rehabilitation des Allgemeinen Krankenhauses in Wien
Die Journalistin Sigrid Kundela wurde am 23. Juni 1992 bei einem Verkehrsunfall schuldlos Opfer eines Autorasers. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde die künstlich beatmete Patientin im Rettungshubschrauber an die unfallchirurgische Notfallaufnahme des Allgemeinen Krankenhauses Wien geflogen. Röntgenaufnahmen zeigten Brüche an der Vorwand der rechten Stirnhöhle und im Bereich des rechten Augenhöhlendaches. Eine Computertomografie des Schädels stellte traumatische Blutungen im Stirnhirnbereich beidseits und eine Schwellung der gesamten Hirnsubstanz dar. Man diagnostizierte ein offenes Schädel-Hirn-Trauma mit Blutergüssen am Brustkorb und an der linken Hüfte. An der Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie wurde der Stirnhöhlenbruch operiert und dabei das knöcherne Augenhöhlendach rekonstruiert. Es folgten mehrere Wochen auf verschiedenen Intensivstationen.
Drei Tage nach dem Unfall konnte Sigrid Kundela wieder selbstständig atmen. Allerdings führten die schweren Schädelverletzungen zu einem posttraumatischen Durchgangssyndrom. Dieses äußerte sich in Verwirrtheit und Unruhezuständen, sodass eine medikamentöse Ruhigstellung und zeitweise eine Fixierung der Arme und Beine notwendig war, um die lebensnotwenige Überwachung und intravenöse Versorgung mit Flüssigkeiten und Nährstoffen zu gewährleisten. Anfang Juli 1992 war Sigrid Kundela bereits mobilisiert und konnte mit Hilfe einer Person wenige Schritte gehen. Kurz später erfolgten die ersten erfolgreichen Essversuche.
Ende Juli wurde die Patientin an die klinische Abteilung für Neurologische Rehabilitation verlegt. Zu diesem Zeitpunkt war die Patientin voll mobilisiert und gab subjektiv keine Beschwerden an. Bedingt durch das anhaltende Durchgangssyndrom war Sigrid Kundela deutlich fehlorientiert und zeitweise unruhig. Weiters fielen Störungen des Gedächtnisses, der Konzentration und des Sprachgebrauches auf. Es bestand eine Erinnerungslücke (Amnesie) bezüglich der Ereignisse der letzten Monate. Sigrid hielt gerne Monologe in englischer Sprache, die mich, verbunden mit ihrer schauspielhaften Mimik und Gestik, an die Königsdramen von Shakespeare erinnerten.
Nach anfänglicher Beurteilung der neurologischen und neuropsychologischen Defizite wurde ein spezifisches Rehabilitationsprogramm mit dem langfristigen Ziel der Wiedereingliederung der Patienten in das Berufsleben entworfen. Die rehabilitativen Maßnahmen sollten vorerst vier bis sechs Wochen stationär an unserer Abteilung durchgeführt werden. Bereits frühzeitig fiel eine mangelnde Krankheitseinsicht, verbunden mit dem hartnäckigen Wunsch, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, auf. Obwohl sich bereits die ersten Fortschritte der Behandlung zeigten, lehnte Sigrid zwei Wochen nach Therapiebeginn einen weiteren Aufenthalt an unserer Abteilung ab. Alle Versuche des Rehabilitationsteams und der beteiligten Familienmitglieder konnten die Patientin nicht umstimmen. Angesichts des hervorragend funktionierenden sozialen Umfeldes, wurde Sigrid entlassen und ambulant weiterbehandelt. Insbesonders die neurologische Behandlung mit Gedächtnis-, Aufmerksamkeit- und Konzentrationstraining führten zu einer langsamen Besserung der Hirnleistungsfunktionen.
Unter Rehabilitation versteht man die Summe der aufeinander abgestimmten Maßnahmen, durch die körperlich und geistig behinderte Menschen bis zum höchsten individuell erreichbaren Grad physischer und geistiger Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden. Als Ziel wird ein angemessener Platz in der Gemeinschaft möglichst dauerhaft angestrebt. Im Rahmen der neurologischen Rehabilitation wird vorerst Ausmaß, Art und Lokalisation der Hirnschädigung mit den entsprechenden neurologischen und neuropsychologischen Defekten festgestellt. Die neurologischen Ausfälle führen zu speziellen Funktionsbeeinträchtigungen im alltäglichen Leben und zu einer Änderung der sozialen, insbesondere der beruflichen Situation. Je nach Behinderung setzt man physiotherapeutische, ergotherapeutische, logopädische und neuropsychologische Behandlungsmethoden in unterschiedlichem Ausmaß ein. Die Art bei der beruflichen Tätigkeit spezifiziert das Rehabilitationsprogramm. Zum Beispiel trainieren Patienten aus handwerklichen Berufen die Feinmotorik im Rahmen der Ergotherapie und verbessern dadurch ihre Geschicklichkeit.
Aus diesen Überlegungen heraus unterstütze ich Sigrid Kundela´s Wunsch, ein Buch über ihr neues Leben zu schreiben, um ihre journalistischen und schriftstellerischen Fähigkeiten zu fördern. Es entstand daraus dieses Buch. Im Handel sind Bücher über medizinische, psychologische und soziologische Probleme von Schädel-Hirn-Trauma Patienten, teilweise vervollständigt mit Texten von Angehörigen erhältlich. Im Gegensatz dazu kann jedoch dieses Buch, verfasst von einer Betroffenen, als Rarität aufgefasst werden. Dem interessierten Leser wird der lange und schwierige Weg einer Rehabilitationspatientin mit mehrmaligen wöchentlichen ergotherapeutischen und neuropsychologischen Therapieeinheiten vor Augen geführt. Das Zusammenspiel von Therapeuten, Ärzten und Angehörigen, die richtige Koordination von medizinischen und organisatorischen Maßnahmen und menschlichen Zuwendungen, machen eine optimale Rehabilitation erst möglich. Die wichtige Rolle von Familie und Freundeskreis im Rahmen der sozialen Wiedereingliederung wird immer wieder eindrucksvoll dargestellt.
Dieses Buch gewährt Einblick in die Gedanken und Gefühlswelt der Patientin Sigrid Kundela. Der posttraumatische Verwirrtheitszustand führt zu einem Verkennen der realen Welt. Die fehlende Erinnerung an den Unfall und nur mäßige neurologische Ausfälle ließen sie vorerst glauben, bloß zu Übungszwecken für Medizinstudenten im Krankenhaus aufgenommen worden zu sein. Es war ein langer Weg, bis Sigrid endlich begriff, dass sie Opfer eines Verkehrsunfalls geworden war.
Die vorliegende Lektüre ist vor allem für Menschen gedacht, die selbst in eine ähnliche Situation geraten sind oder als Angehörige indirekt davon betroffen waren. Die neurologische Rehabilitation gehört nicht zu den Gebieten der Medizin mit der sich schnelle und spektakuläre Erfolge erzielen lassen. Die Summe der kleinen Schritte führt oft erst nach Jahren zum Ziel. Dazu bedarf es im gleichen Maße der Ausdauer der Patienten und der Motivation eines einfühlsamen Rehabilitationsteams.
Peter Schnider

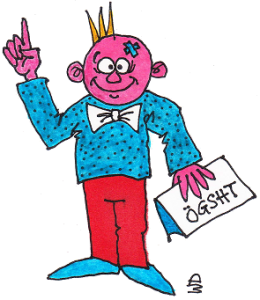



Neueste Kommentare